19. April 2014 |
 Ruhig geworden in meinem Blog es ist. Und einen Grund dafür es gibt. Unglaublich, aber wahr: Ich war knapp vier Wochen lang nicht im Kino. Doch keine Angst, ich lebe noch. Und es geht mir gut. Ich hatte in letzter Zeit lediglich mehr Lust auf Videospiele als auf Kinofilme. Doch in den letzten vier Tagen war ich endlich wieder fleißig und habe insgesamt vier Filme geschaut, zu denen es nun nach und nach die dazugehörigen Reviews geben wird. Los geht’s mit „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ …
Ruhig geworden in meinem Blog es ist. Und einen Grund dafür es gibt. Unglaublich, aber wahr: Ich war knapp vier Wochen lang nicht im Kino. Doch keine Angst, ich lebe noch. Und es geht mir gut. Ich hatte in letzter Zeit lediglich mehr Lust auf Videospiele als auf Kinofilme. Doch in den letzten vier Tagen war ich endlich wieder fleißig und habe insgesamt vier Filme geschaut, zu denen es nun nach und nach die dazugehörigen Reviews geben wird. Los geht’s mit „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ …
Worum geht’s
Peter Parker (Andrew Garfield) hat mit der Vergangenheit zu kämpfen. Sein Versprechen gegenüber dem verstorbenen Captain Stacy, Abstand zu dessen Tochter Gwen (Emma Stone) zu halten, belastet die Beziehung der beiden stark. Und auch das Verschwinden seiner Eltern lässt Peter keine Ruhe. Seine Ermittlungen führen ihn Schritt für Schritt in Richtung Oscorp. Dort hat inzwischen Peters Jugendfreund Harry Osborn (Dane DeHaan) die Leitung übernommen. Harry leidet unter derselben tödlichen Krankheit, die bereits seinem Vater Norman das Leben kostete und hofft, dass ihm dessen Forschungen das Leben retten können. Harry vermutet, dass die Lösung in Spider-Mans Blut liegen könnte. Um dieses zu bekommen, verbündet er sich mit Max Dillon (Jamie Foxx), der seit einem schweren Unfall die Fähigkeit besitzt, Elektrizität zu absorbieren und für seine Zwecke zu nutzen …
 Meine Meinung
Meine Meinung
Puh, es ist gar nicht einfach, zu beschreiben, worum es in „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ geht, ohne zu viel zu schreiben und vor allem zu viel zu verraten. Und damit komme ich ohne große Umschweife auch gleich zu dem großen Problem, das ich mit dem Film habe: Er ist, trotz seiner Laufzeit von immerhin 142 Minuten, einfach viel zu überladen. Im Laufe des Films werden so viele Handlungsstränge aufgebaut, dass irgendwann nicht mehr klar ist, worum es nun eigentlich genau geht. Das Schicksal von Peters Eltern und Oscorps Beteiligung daran? Harrys tödliche Krankheit und dessen Suche nach einer Heilung? Max Dillons tragische Verwandlung vom unbedeutenden Niemand zum Superschurken Electro? Die Beziehung zwischen Peter und Gwen, die unter Peters Doppelleben zu leiden hat? Oder geht es doch eher um den generellen Umgang mit Macht, Verantwortung und Trauer? Letztlich hängt wie so oft zwar alles irgendwie zusammen, doch dadurch, dass versucht wird, so viele Handlungsstränge gleichberechtigt unter einen Hut zu bringen, scheitert der Film an seiner eigenen, allerdings nur scheinbaren, Komplexität. Denn letztlich bleibt der Film ironischerweise erschreckend oberflächlich. Besonders deutlich wird dies an den beiden Superschurken, deren Entstehung nicht nur viel zu schnell vonstattengeht, sondern die auch jegliche charakterliche Tiefe vermissen lassen. Beide werden als tragische Figuren eingeführt, dann wird einfach ein Schalter umgelegt und klick, ist die Figur abgrundtief böse. Für die inneren Kämpfe, die einen Superschurken üblicherweise nach dessen Verwandlung begleiten, ist hier schlicht kein Platz. Ganz ehrlich, das haben der erste Teil und vor allem Sam Raimi in seiner Trilogie wesentlich besser hinbekommen.
 Doch versteht mich bitte nicht falsch, „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ ist kein Totalausfall. Der Film ist sogar äußerst unterhaltsam. Die Action wurde spektakulär inszeniert, ist tricktechnisch auf dem neuesten Stand und bietet einige wirklich beeindruckende Schauwerte. Der Humoranteil wurde deutlich ausgebaut und bietet genau die richtige Mischung aus Spider-Mans typischen Albernheiten und gelungener Situationskomik. Die Darsteller, allen voran natürlich Andrew Garfield als Peter Parker und Emma Stone als Gwen Stacy, passen nach wie vor wie die Faust aufs Auge. Und dank seiner zahlreichen Handlungsstränge und Nebenkriegsschauplätze ist sichergestellt, dass immer irgendwo irgendwas passiert und der Film trotz seiner Laufzeit nie langweilig wird.
Doch versteht mich bitte nicht falsch, „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ ist kein Totalausfall. Der Film ist sogar äußerst unterhaltsam. Die Action wurde spektakulär inszeniert, ist tricktechnisch auf dem neuesten Stand und bietet einige wirklich beeindruckende Schauwerte. Der Humoranteil wurde deutlich ausgebaut und bietet genau die richtige Mischung aus Spider-Mans typischen Albernheiten und gelungener Situationskomik. Die Darsteller, allen voran natürlich Andrew Garfield als Peter Parker und Emma Stone als Gwen Stacy, passen nach wie vor wie die Faust aufs Auge. Und dank seiner zahlreichen Handlungsstränge und Nebenkriegsschauplätze ist sichergestellt, dass immer irgendwo irgendwas passiert und der Film trotz seiner Laufzeit nie langweilig wird.
 Und dennoch ist der Film nicht viel mehr als ein Sammelsurium vieler gelungener Einzelszenen, die für sich betrachtet durchaus unterhaltsam und interessant sind, aber leider niemals so recht ineinander greifen und ein großes Ganzes ergeben wollen. Ich hoffe, dass der für 2016 bereits angekündigte „The Amazing Spider-Man 3“ eine bessere Mischung findet.
Und dennoch ist der Film nicht viel mehr als ein Sammelsurium vieler gelungener Einzelszenen, die für sich betrachtet durchaus unterhaltsam und interessant sind, aber leider niemals so recht ineinander greifen und ein großes Ganzes ergeben wollen. Ich hoffe, dass der für 2016 bereits angekündigte „The Amazing Spider-Man 3“ eine bessere Mischung findet.
Mein Fazit
Unterhaltsame Comicverfilmung mit sympathischen Darstellern und beeindruckenden Effekten, die mehr erzählen will, als es die Laufzeit zulässt. Und letztlich genau daran scheitert.
Meine Wertung: 6/10
15. März 2014 |
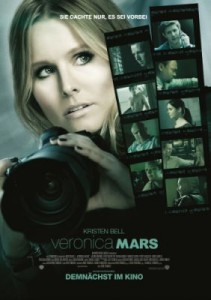 135,- Dollar. Das ist der Betrag, den ich im Rahmen der Kickstarter-Kampagne beigesteuert habe, um die Privatdetektivin Veronica Mars nach ihrem ungerechtfertigten Serien-Aus ins Kino zu bringen. 194,6 Kilometer. Das ist die Entfernung, die meine (glücklicherweise von Veronica ebenfalls begeisterte) bessere Hälfte und ich gestern zurückgelegt haben, um den Film auf der großen Leinwand zu sehen. Ob sich Investition und Fahrt gelohnt haben, erfahrt ihr … ach, was soll’s: Ja verdammt, es hat sich gelohnt!
135,- Dollar. Das ist der Betrag, den ich im Rahmen der Kickstarter-Kampagne beigesteuert habe, um die Privatdetektivin Veronica Mars nach ihrem ungerechtfertigten Serien-Aus ins Kino zu bringen. 194,6 Kilometer. Das ist die Entfernung, die meine (glücklicherweise von Veronica ebenfalls begeisterte) bessere Hälfte und ich gestern zurückgelegt haben, um den Film auf der großen Leinwand zu sehen. Ob sich Investition und Fahrt gelohnt haben, erfahrt ihr … ach, was soll’s: Ja verdammt, es hat sich gelohnt!
Worum geht’s
Vor neun Jahren hat Veronica Mars (Kristen Bell) ihrer Heimatstadt Neptune und damit auch ihrem Leben als Privatdetektivin den Rücken gekehrt und arbeitet nun als Anwältin in New York. Als in den Nachrichten gemeldet wird, dass eine ehemalige Klassenkameradin ermordet wurde und Veronicas Exfreund Logan (Jason Dohring) als Tatverdächtiger gilt, reist Veronica nach Neptune, um Logan bei der Wahl eines Verteidigers zu unterstützen. Doch Veronica wäre nicht Veronica, wenn sie nicht mit eigenen Ermittlungen beginnen würde …
 Meine Meinung
Meine Meinung
Bevor ihr weiterlest, solltet ihr euch eines klar machen: Ich bin ein Marshmallow. Aus tiefstem Herzen und voller Überzeugung. „Veronica Mars“ gehört für mich trotz der im Vergleich zum genialen Auftakt schwächeren dritten Staffel zu den besten und vermutlich unterschätzten Serien der letzten Jahren. Was ich euch damit sagen möchte? Ganz einfach: Sofern ihr kein Fan der Serie seid, dürft ihr meine Begeisterung mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen und von meiner Wertung zum Film zwei bis drei Punkte abziehen. Denn eines ist ganz klar: „Veronica Mars“ ist ein Film für Fans. Durch und durch.
 Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass „Veronica Mars“ nur für Fans genießbar wäre. Auch Neueinsteiger dürften mit der sympathischen Hauptfigur ihren Spaß haben. Zugegeben, der Mord an ihrer ehemaligen Klassenkameradin gehört nicht zu Veronicas stärksten Fällen, stellt aber ein solides, wenn auch nicht sonderlich spannendes Wer-hat’s-warum-getan-Rätsel-dar. Nichts zum Nägel kaufen, aber auch nichts zum Einschlafen. Viel wichtiger als des Rätsels Lösung ist ohnehin der Weg dorthin. Und dieser ist einmal mehr geprägt von Veronicas Spürsinn, gewitzten Ermittlungsmethoden nah an der Grenze der Legalität (und auch darüber hinaus) und natürlich zahlreichen bissigen Dialogen gepaart mit sarkastischer Schlagfertigkeit. Nein, um diese kurzweilige Kombination aus Krimi und Komödie genießen zu können, muss man glücklicherweise weder ein langjähriger Fan der Serie noch ein Fan speziell von Kristen Bell sein.
Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass „Veronica Mars“ nur für Fans genießbar wäre. Auch Neueinsteiger dürften mit der sympathischen Hauptfigur ihren Spaß haben. Zugegeben, der Mord an ihrer ehemaligen Klassenkameradin gehört nicht zu Veronicas stärksten Fällen, stellt aber ein solides, wenn auch nicht sonderlich spannendes Wer-hat’s-warum-getan-Rätsel-dar. Nichts zum Nägel kaufen, aber auch nichts zum Einschlafen. Viel wichtiger als des Rätsels Lösung ist ohnehin der Weg dorthin. Und dieser ist einmal mehr geprägt von Veronicas Spürsinn, gewitzten Ermittlungsmethoden nah an der Grenze der Legalität (und auch darüber hinaus) und natürlich zahlreichen bissigen Dialogen gepaart mit sarkastischer Schlagfertigkeit. Nein, um diese kurzweilige Kombination aus Krimi und Komödie genießen zu können, muss man glücklicherweise weder ein langjähriger Fan der Serie noch ein Fan speziell von Kristen Bell sein.
 Dieser sollte man jedoch sein, um den Film als Gesamtwerk und Fanservice würdigen zu können. Denn „Veronica Mars“ enthält so viele Gastauftritte, Anspielungen und Insiderwitze, dass man ihn vermutlich mehrmals sehen muss, um nichts zu verpassen. Von der Kickstarter-Finanzierung des Films über die leider nie gedrehte vierte Staffel bis hin zu Anspielungen auf Kristen Bells Schwangerschaft wurde so ziemlich alles in den Film gepackt, was irgendwie sinnvoll (oder auch weniger sinnvoll) verwendet werden konnte. Hinzu gesellen sich zahlreiche, teilweise nur wenige Sekunden lange Gastauftritte, bei denen es, so viel sei verraten, nicht verkehrt ist, sich mit Kristens Familienverhältnissen auszukennen. Als Fan sitzt man dabei freudestrahlend in seinem Kinosessel und kichert von Minute zu Minute zufriedener in sich hinein, während Außenstehende sich vermutlich fragen dürften, ob die letzten Sekunden irgendeine tiefere Bedeutung hatten.
Dieser sollte man jedoch sein, um den Film als Gesamtwerk und Fanservice würdigen zu können. Denn „Veronica Mars“ enthält so viele Gastauftritte, Anspielungen und Insiderwitze, dass man ihn vermutlich mehrmals sehen muss, um nichts zu verpassen. Von der Kickstarter-Finanzierung des Films über die leider nie gedrehte vierte Staffel bis hin zu Anspielungen auf Kristen Bells Schwangerschaft wurde so ziemlich alles in den Film gepackt, was irgendwie sinnvoll (oder auch weniger sinnvoll) verwendet werden konnte. Hinzu gesellen sich zahlreiche, teilweise nur wenige Sekunden lange Gastauftritte, bei denen es, so viel sei verraten, nicht verkehrt ist, sich mit Kristens Familienverhältnissen auszukennen. Als Fan sitzt man dabei freudestrahlend in seinem Kinosessel und kichert von Minute zu Minute zufriedener in sich hinein, während Außenstehende sich vermutlich fragen dürften, ob die letzten Sekunden irgendeine tiefere Bedeutung hatten.
 Bei aller Euphorie als Fan muss allerdings selbst ich zugeben, dass der Film zuweilen ein wenig überladen wirkt. So sehr es mich auch freut, dass versucht wurde, so viele Serienfiguren wie möglich in dem Film unterzubringen, so wenig kann ich leugnen, dass deren Auftritte teilweise den Eindruck hinterlassen, als wären die Figuren nur der Vollständigkeit halber dabei. Und einige offen bleibende Handlungsstränge jenseits des Mordfalls erwecken durchaus den Eindruck, als würde hier schon auf einen weiteren Film oder gar eine neue Serienstaffel hingearbeitet werden. Aber sei’s drum, dem Spaß am Film tut dies keinen echten Abbruch.
Bei aller Euphorie als Fan muss allerdings selbst ich zugeben, dass der Film zuweilen ein wenig überladen wirkt. So sehr es mich auch freut, dass versucht wurde, so viele Serienfiguren wie möglich in dem Film unterzubringen, so wenig kann ich leugnen, dass deren Auftritte teilweise den Eindruck hinterlassen, als wären die Figuren nur der Vollständigkeit halber dabei. Und einige offen bleibende Handlungsstränge jenseits des Mordfalls erwecken durchaus den Eindruck, als würde hier schon auf einen weiteren Film oder gar eine neue Serienstaffel hingearbeitet werden. Aber sei’s drum, dem Spaß am Film tut dies keinen echten Abbruch.
Mein Fazit
Auf Fans ausgerichtete, aber auch für Neueinsteiger genießbare Kriminalkomödie mit äußerst sympathischer Titelheldin, der man den Spaß aller Beteiligten in jeder Sekunde anmerkt.
Meine Wertung: 9/10 (inkl. Fanbonus)
Zum Schluss noch weitere Stimmen aus der deutschen Film-Blogosphäre:
Filmherum
Medienjournal
Tonight is gonna be a large one.
9. März 2014 |
 Schon wieder habe ich mit meinem Filmtipp richtig gelegen! Ich denke, so langsam sollte ich über eine Karriere bei AstroTV nachdenken. Zumindest als Hellseher für Sneak-Previews hätte ich gute Chancen auf treffsichere Zukunftsaussagen. Nur ob ich davon leben könnte? Ich tue mich gerade etwas schwer damit, den Markt leichtgläubiger Kinogänger, die bereit wären, Geld für meine Vorhersagen auszugeben, realistisch einzuschätzen. Vielleicht bleibe ich doch lieber bei meinem jetzigen Job. Und konzentriere mich nun auf meine Review zu „Non-Stop“ …
Schon wieder habe ich mit meinem Filmtipp richtig gelegen! Ich denke, so langsam sollte ich über eine Karriere bei AstroTV nachdenken. Zumindest als Hellseher für Sneak-Previews hätte ich gute Chancen auf treffsichere Zukunftsaussagen. Nur ob ich davon leben könnte? Ich tue mich gerade etwas schwer damit, den Markt leichtgläubiger Kinogänger, die bereit wären, Geld für meine Vorhersagen auszugeben, realistisch einzuschätzen. Vielleicht bleibe ich doch lieber bei meinem jetzigen Job. Und konzentriere mich nun auf meine Review zu „Non-Stop“ …
Worum geht’s
Während eines Fluges über den Atlantik erhält der Flugsicherheitsbegleiter Bill Marks (Liam Neesen) auf seinem gesicherten Telefon eine Nachricht. Ein Unbekannter fordert 150 Millionen Dollar und droht damit, alle 20 Minuten eine Person in dem Flugzeug zu töten, sollte seine Forderung nicht erfüllt werden. Während Marks verzweifelt versucht, den Absender der Nachricht zu identifizieren, findet die Flugsicherung heraus, dass das Zielkonto auf Marks eigenen Namen lautet …
 Meine Meinung
Meine Meinung
Es gibt Filme, über die man nur wenig schreiben sollte, weil man sonst zu viel von der Handlung verrät. Und es gibt Filme, über die man nur wenig schreiben kann, weil die Handlung schlicht zu dürftig ist. Auf Jaume Collet-Serras („Orphan – Das Waisenkind“, „Unknown Identity“) Actionthriller „Non-Stop“ trifft irgendwie beides zu. Ein Flugzeug wird entführt, der Flugsicherheitsbegleiter gerät in Verdacht und muss nicht nur die Passagiere retten, sondern gleichzeitig seine Unschuld beweisen. So in etwa lässt sich „Non-Stop“ problemlos in einem Satz zusammenfassen. Wenig überraschend lautet die Frage dann auch nicht, ob Liam Neeson den Tag rettet, sondern nur, wie er das anstellt. Und die Antwort darauf lautet: höchst unterhaltsam!
 Auch wenn die Auflösung ein wenig hanebüchen daherkommt (keine Angst: so absurd wie in „Flight Plan“ wird es glücklicherweise zu keiner Zeit), überzeugt „Non-Stop“ mit seinem interessanten Ausgangspunkt, einer von Anfang bis Ende äußerst straffen Inszenierung und geschickt platzierten falschen Fährten. Und natürlich mit Liam Neeson, der den mürrischen Einzelgänger inzwischen aus dem Effeff beherrscht, in den wenigen Actionszenen körperlich nach wie vor eine gute Figur macht und schlicht eine coole Sau ist, die das Publikum mit nur einem störrischen Blick zum Schmunzeln bringt. Schmunzeln dürft ihr in „Non-Stop“ übrigens öfter, denn trotz der durchaus ernsten Thematik nimmt sich der Film erfreulicherweise nur so ernst wie absolut nötig und lockert das Geschehen immer mal wieder mit ironischen Situationen und flapsigen Dialogen auf.
Auch wenn die Auflösung ein wenig hanebüchen daherkommt (keine Angst: so absurd wie in „Flight Plan“ wird es glücklicherweise zu keiner Zeit), überzeugt „Non-Stop“ mit seinem interessanten Ausgangspunkt, einer von Anfang bis Ende äußerst straffen Inszenierung und geschickt platzierten falschen Fährten. Und natürlich mit Liam Neeson, der den mürrischen Einzelgänger inzwischen aus dem Effeff beherrscht, in den wenigen Actionszenen körperlich nach wie vor eine gute Figur macht und schlicht eine coole Sau ist, die das Publikum mit nur einem störrischen Blick zum Schmunzeln bringt. Schmunzeln dürft ihr in „Non-Stop“ übrigens öfter, denn trotz der durchaus ernsten Thematik nimmt sich der Film erfreulicherweise nur so ernst wie absolut nötig und lockert das Geschehen immer mal wieder mit ironischen Situationen und flapsigen Dialogen auf.
 All dies macht aus „Non-Stop“ einen zwar nicht anspruchsvollen, dafür aber umso sympathischeren und extrem kurzweiligen Gute-Laune-Thriller, irgendwo zwischen „Taken“, „Flight Plan“ und „Snakes On A Plane“. Damit ist „Non-Stop“ genau das Richtige für einen entspannten und befriedigenden Filmabend nach Feierabend. Wirklich bedauerlich ist eigentlich nur, dass am Ende zwei, drei Handlungslücken offen bleiben und Julianne Moore in ihrer Rolle trotz Verdachtsmomente und persönlichem Schicksal ein wenig verschenkt wirkt …
All dies macht aus „Non-Stop“ einen zwar nicht anspruchsvollen, dafür aber umso sympathischeren und extrem kurzweiligen Gute-Laune-Thriller, irgendwo zwischen „Taken“, „Flight Plan“ und „Snakes On A Plane“. Damit ist „Non-Stop“ genau das Richtige für einen entspannten und befriedigenden Filmabend nach Feierabend. Wirklich bedauerlich ist eigentlich nur, dass am Ende zwei, drei Handlungslücken offen bleiben und Julianne Moore in ihrer Rolle trotz Verdachtsmomente und persönlichem Schicksal ein wenig verschenkt wirkt …
Mein Fazit
Etwas an den Haaren herbeigezogener, aber durchweg spannender und vor allem unterhaltsamer Flugzeug-Thriller mit einem herrlich grummeligen Liam Neeson und einer leider unterforderten Julianne Moore.
Meine Wertung: 8/10
27. Februar 2014 |
 Achtung, wichtige Warnung: Aufgrund akuter Müdigkeit zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Review kann der nun folgende Text Spuren von zusammenhanglosen Sätzen und wirrem Geschreibsel enthalten. Ich bitte dies zu entschulddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd … bin wach! Bin wach!
Achtung, wichtige Warnung: Aufgrund akuter Müdigkeit zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Review kann der nun folgende Text Spuren von zusammenhanglosen Sätzen und wirrem Geschreibsel enthalten. Ich bitte dies zu entschulddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd … bin wach! Bin wach!
Worum geht’s
Der 11. September 2001 hat viele Leben verändert. So auch das von Jack Ryan (Chris Pine), der sich als Reaktion auf die Anschläge den Marines anschließt, statt sein Studium zu beenden. In Afghanistan wird Jack jedoch so schwer verletzt, dass seine Karriere ein jähes Ende findet. Während die angehende Ärztin Cathy Muller (Keira Knightley) alles daran setzt, Jacks körperliche Gesundheit wieder herzustellen, tritt CIA-Agent Thomas Harper (Kevin Costner) an Jack heran und rekrutiert ihn als CIA-Analyst. 10 Jahre später arbeitet Jack undercover an der Wall Street. Dort entdeckt er verdächtige Geldströme, die zu dem russischen Oligarchen Viktor Cherevin (Kenneth Branagh) führen. Harper schickt Jack nach Russland, um die Hintergründe aufzudecken. Doch kaum in Moskau angekommen, wird auf Jack ein Mordanschlag verübt. Mit Hilfe von Harper und Cathy findet Jack heraus, dass Cherevin einen Anschlag plant, der Amerikas Wirtschaft ruinieren könnte …
 Meine Meinung
Meine Meinung
Es wird Zeit für eine Beichte: Obwohl „Jagd auf Roter Oktober“ seit mindestens einem Jahrzehnt in meinem Filmregal steht, habe ich den Film bis heute nicht gesehen. Und trotz ihres guten Rufes sind sowohl „Die Stunde der Patrioten“ als auch „Das Kartell“ in meinem Gedächtnis eher der Kategorie „ganz okay“ zugeordnet. Wirklich begeistern konnte mich bislang lediglich „Der Anschlag“, dessen zweite Hälfte ich zu meinen fesselndsten Kinomomenten zähle. Und ja, ich finde es immer noch schade, dass Ben Affleck den gewieften Analysten nur ein einziges Mal verkörpern durfte. Steinigt mich doch!
Treu nach dem Motto „Reboot tut gut!“ darf sich ab heute stattdessen Chris Pine in einem Neuanfang der Serie beweisen. Nun müssen Reboots einer Filmreihe prinzipiell weiß Gott nichts Schlechtes sein. Wenn sie unterhaltsam sind, alte Gewohnheiten abschütteln und der bereits bekannten Geschichte neue Facetten hinzufügen können, warum nicht? Doch um es gleich vorweg zu nehmen: Trotz guter Besetzung kann Kenneth Branaghs „Jack Ryan: Shadow Recruit“ die Hoffnung auf einen würdigen Neuanfang nur teilweise erfüllen.
 Die gute Nachricht: An Chris Pine scheitert der Film definitiv nicht. Pines Darstellung ist engagiert, zuweilen überraschend vielschichtig und empfiehlt ihn durchaus für zukünftige Jack-Ryan-Abenteuer. Dasselbe gilt für Kevin Costner, der als väterlicher Mentor mit Rat und Tat zur Seite steht – wenn’s darauf ankommt, auch mit dem Gewehr im Anschlag. Auch Keira Knightley weiß (nicht nur optisch) zu gefallen, obgleich ihre Entwicklung von Jack Ryans misstrauischer Freundin hin zum unverzichtbaren Teammitglied arg unglaubwürdig und zuweilen unfreiwillig komisch wirkt. Doch das ist immer noch besser als Kenneth Branagh, der als russischer Bösewicht zwar solide aufspielt, jedoch zum reinen Abziehbild alter Feindbilder verkommt.
Die gute Nachricht: An Chris Pine scheitert der Film definitiv nicht. Pines Darstellung ist engagiert, zuweilen überraschend vielschichtig und empfiehlt ihn durchaus für zukünftige Jack-Ryan-Abenteuer. Dasselbe gilt für Kevin Costner, der als väterlicher Mentor mit Rat und Tat zur Seite steht – wenn’s darauf ankommt, auch mit dem Gewehr im Anschlag. Auch Keira Knightley weiß (nicht nur optisch) zu gefallen, obgleich ihre Entwicklung von Jack Ryans misstrauischer Freundin hin zum unverzichtbaren Teammitglied arg unglaubwürdig und zuweilen unfreiwillig komisch wirkt. Doch das ist immer noch besser als Kenneth Branagh, der als russischer Bösewicht zwar solide aufspielt, jedoch zum reinen Abziehbild alter Feindbilder verkommt.
 Und damit sind wir auch schon bei dem Grundproblem des Films angekommen: Er bietet nur altbekannte Kost. Und was noch schlimmer ist: Er verpackt diese nicht mal sonderlich gut. Die durchaus nicht uninteressante Geschichte wird pflichtbewusst, aber überraschungs- und leider auch recht spannungsarm vorangetrieben. Jacks Einbruch in Cherevins EDV-System, während selbiger von Cathy beim Abendessen abgelenkt wird, gehört sicherlich zu den besseren Momenten, lädt den genreerprobten Zuschauer aber auch nicht gerade zum Fingernägelkauen ein. Und die wenigen Actionszenen in Form kurzer Prügeleien, Schießereien und Verfolgungsjagden sind zwar solide inszeniert, zeigen aber auch nichts, was man nicht anderswo schon spektakulärer und vor allem packender gesehen hat.
Und damit sind wir auch schon bei dem Grundproblem des Films angekommen: Er bietet nur altbekannte Kost. Und was noch schlimmer ist: Er verpackt diese nicht mal sonderlich gut. Die durchaus nicht uninteressante Geschichte wird pflichtbewusst, aber überraschungs- und leider auch recht spannungsarm vorangetrieben. Jacks Einbruch in Cherevins EDV-System, während selbiger von Cathy beim Abendessen abgelenkt wird, gehört sicherlich zu den besseren Momenten, lädt den genreerprobten Zuschauer aber auch nicht gerade zum Fingernägelkauen ein. Und die wenigen Actionszenen in Form kurzer Prügeleien, Schießereien und Verfolgungsjagden sind zwar solide inszeniert, zeigen aber auch nichts, was man nicht anderswo schon spektakulärer und vor allem packender gesehen hat.
Hinzu gesellen sich unnötige Logiklöcher, die keinen Analysten benötigen, um sie zu erkennen. Wieso Jack Ryan nach seiner Ankunft in Russland nicht zügig erschossen, sondern erst durch halb Moskau bis in sein Hotel kutschiert wird, gehört mit Blick auf den löcherigen Masterplan da noch zu den harmloseren Fragen.
Mein Fazit
Solider Agententhriller ohne echte Höhepunkte, dessen einfallslose Inszenierung enttäuscht, während die Besetzung durchaus Lust auf mehr macht.
Meine Wertung: 6/10
3. Januar 2014 |
 Bevor ich mit meiner Review beginne, möchte ich die besinnliche Nachweihnachtszeit nutzen, um eine freundliche Bitte auszusprechen:
Bevor ich mit meiner Review beginne, möchte ich die besinnliche Nachweihnachtszeit nutzen, um eine freundliche Bitte auszusprechen:
Liebe Mädchen,
es freut mich sehr, dass ihr euch für Horrorfilme interessiert. Ich kann eure Faszination für dieses Genre voll und ganz nachvollziehen. Und bin sogar ein wenig neidisch, dass Horrorfilme euch noch Gänsehaut bescheren und Schrecken einjagen können. Ganz ehrlich, eure Angstschreie im Kino finde ich nicht nur unterhaltsam, sondern meist sogar stimmungsfördernd.
Doch um eine Kleinigkeit möchte ich euch dennoch bitten: Sofern ihr zu den Zuschauerinnen gehört, die Horrorfilme nur überstehen können, indem sie ununterbrochen reden, Blödsinn machen und kichern, dann …
SCHAUT EUCH HORRORFILME GEFÄLLIGST IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN UND NICHT IM KINO AN! IHR NERVT!
Vielen Dank. Hab euch lieb. Und nun viel Spaß beim Lesen meiner Review.
 Worum geht’s
Worum geht’s
Jesse (Andrew Jacobs) ist 18 Jahre alt, hat seinen Highschool-Abschluss frisch in der Tasche und möchte nun vor allem Blödsinn machen und das Leben genießen. Bevorzugt mit seinem besten Freund Hector (Jorge Diaz). Als Jesses verschrobene Nachbarin Anna (Gloria Sandoval) tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird, beschließen die beiden, sich die Wohnung der Verstorbenen genauer anzuschauen. Bei ihrem nächtlichen Streifzug durch die fremde Wohnung stoßen Jesse und Hector nicht nur auf zahlreiche okkulte Gegenstände, sondern auch auf diverse Fotos von Jesse, die auf einer Art Altar ausgebreitet wurden. Während Hector und Marisol (Gabrielle Walsh) versuchen, die Zusammenhänge zu enträtseln, fängt Jesse an, merkwürdige Veränderungen an sich festzustellen …
 Meine Meinung
Meine Meinung
Wer hätte gedacht, dass „Paranormal Activity“ sich zu einer solch langlebigen Filmreihe entwickeln würde. Nun, ich zumindest nicht. Und das Beste daran ist, dass die Filme zwar stets demselben Muster folgen, die Verantwortlichen aber, vom enttäuschenden „Paranormal Activity 4“ einmal abgesehen, glücklicherweise darauf verzichten, die Geschichte stupide fortzusetzen. Stattdessen wird die ursprüngliche Handlung um Katie und Kristi nach und nach erweitert, was inzwischen zwar mehr Fragen aufwirft als Antworten zu geben, mir insgesamt aber deutlich besser gefällt als der typische Fortsetzungswahn. Auch „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ macht hier keine Ausnahme, so dass es durchaus sinnvoll ist, sich vor dem Gang ins Kino zumindest die ersten drei Teile der Reihe noch mal frisch in Erinnerung zu rufen. Denn auch wenn der aktuelle Ableger relativ unabhängig zu sein scheint, dürften „Paranormal Activity“-Unkundige spätestens im letzten Drittel nur noch ein großes Fragezeichen vor sich sehen.
 Wie bislang alle Teile der Reihe setzt auch „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ auf den inzwischen doch recht abgenutzt wirkenden Found-Footage-Stil und die für dieses Genre typischen Schreckmomente. Das mag vielleicht alles andere als innovativ sein, ist aber, zumindest den im Kinosaal schreienden Damen nach zu urteilen, offenbar immer noch höchst effektiv. Auch den langsamen Spannungsaufbau und das hektische Finale, in dem die Brücke zu den ersten drei Teilen der Reihe gespannt wird, teilt sich der Film mit seinen Vorgängern. Worin sich „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ jedoch unterscheidet, ist sein recht ausgeprägter Humor. Die erste Hälfte wirkt fast wie eine Komödie, was den Film nicht nur kurzweiliger werden lässt, sondern gleichzeitig dafür sorgt, dass einem die Figuren überraschend sympathisch sind und deren Schicksal einem nicht am Allerwertesten vorbei geht. „Paranormal Activity“ entwickelt sich also durchaus weiter. Zwar nur ein bisschen und in eine unerwartet lockere Richtung, aber genug, um der Reihe nach dem belanglosen vierten Teil wieder eine Chance zu geben!
Wie bislang alle Teile der Reihe setzt auch „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ auf den inzwischen doch recht abgenutzt wirkenden Found-Footage-Stil und die für dieses Genre typischen Schreckmomente. Das mag vielleicht alles andere als innovativ sein, ist aber, zumindest den im Kinosaal schreienden Damen nach zu urteilen, offenbar immer noch höchst effektiv. Auch den langsamen Spannungsaufbau und das hektische Finale, in dem die Brücke zu den ersten drei Teilen der Reihe gespannt wird, teilt sich der Film mit seinen Vorgängern. Worin sich „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ jedoch unterscheidet, ist sein recht ausgeprägter Humor. Die erste Hälfte wirkt fast wie eine Komödie, was den Film nicht nur kurzweiliger werden lässt, sondern gleichzeitig dafür sorgt, dass einem die Figuren überraschend sympathisch sind und deren Schicksal einem nicht am Allerwertesten vorbei geht. „Paranormal Activity“ entwickelt sich also durchaus weiter. Zwar nur ein bisschen und in eine unerwartet lockere Richtung, aber genug, um der Reihe nach dem belanglosen vierten Teil wieder eine Chance zu geben!
Mein Fazit
Überraschend kurzweiliger Ableger der beliebten „Paranormal Activity“-Reihe, der mit viel Humor, sympathischen Figuren und einer durchaus interessanten Geschichte punkten kann. Was die Spannung und die Schockmomente angeht, dürfen sich die Macher aber so langsam mal etwas Neues einfallen lassen …
Meine Wertung: 7/10
4. Dezember 2013 |
 Mit „Carrie – Des Satans jüngste Tochter“ schuf Regisseur Brian De Palma 1976 eine der meiner Meinung nach besten Stephen-King-Verfilmungen aller Zeiten. Und einen Film, der aufgrund seiner zeitlosen Geschichte auch heute noch ohne große Abstriche hervorragend funktioniert. Morgen startet die mit Chloë Grace Moretz und Julianne Moore prominent besetzte Neuverfilmung in unseren Kinos. Ob sich der Kinobesuch lohnt oder ihr euer Geld lieber in die frisch erschienene Blu-ray des Originals investieren solltet, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest …
Mit „Carrie – Des Satans jüngste Tochter“ schuf Regisseur Brian De Palma 1976 eine der meiner Meinung nach besten Stephen-King-Verfilmungen aller Zeiten. Und einen Film, der aufgrund seiner zeitlosen Geschichte auch heute noch ohne große Abstriche hervorragend funktioniert. Morgen startet die mit Chloë Grace Moretz und Julianne Moore prominent besetzte Neuverfilmung in unseren Kinos. Ob sich der Kinobesuch lohnt oder ihr euer Geld lieber in die frisch erschienene Blu-ray des Originals investieren solltet, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest …
Worum geht’s
Die 16-jährige Carrie White (Chloë Grace Moretz) lebt ohne Vater bei ihrer dominanten Mutter Margaret (Julianne Moore), einer religiösen Fanatikerin. Ihre weltfremde Unbeholfenheit und ihre Verschlossenheit lassen Carrie oft zum Spott ihrer Mitschüler werden. Als Carrie nach dem Schulsport in der Dusche ihre erste Periode bekommt, gerät sie in Panik, worüber sich ihre Mitschülerinnen rücksichtslos lustig machen. Lediglich Sue (Gabriella Wilde) zeigt nach dem Vorfall Mitgefühl und überzeugt ihren Freund Tommy (Ansel Elgort) davon, Carrie zum Schulball einzuladen. Gegen den Willen ihrer Mutter, die in Carries Entwicklung zur Frau die pure Sünde zu erkennen glaubt, sagt Carrie zu. Als sie auf dem Ball Opfer eines geschmacklosen Streiches wird, brechen all die Demütigungen und der Zorn der letzten Jahre über Carrie herein – und entladen sich in Form telekinetischer Fähigkeiten, die seit jeher in Carrie schlummern …
 Meine Meinung
Meine Meinung
Ich kenne nur wenige Geschichten, die das Drama und den Horror so gekonnt vereinen wie Stephen Kings „Carrie“. Davon profitiert auch Kimberly Peirces Neuverfilmung, die zwar wenig neues zu bieten hat, der man sich als Mensch mit schlagendem Herzen aber dennoch nur schwer entziehen kann. Ganz ehrlich, wer mit Carrie White kein Mitleid hat, sollte sich dringend auf seine Menschlichkeit hin untersuchen lassen. Selbst im Finale, in dem sie zum tödlichen Racheengel mutiert, kann man Carrie ihre Taten nicht wirklich übelnehmen, da ihre Reaktion auf die tragischen Ereignisse nur allzu menschlich ausfällt.
Chloë Grace Moretz, die bereits in „Let Me In“ bewiesen hat, dass ihr solche Charaktere liegen, versteht es auch hier eindrucksvoll, der verletzlichen und unsicheren Carrie Leben einzuhauchen. Im Gegensatz zu Sissy Spacek, deren Carrie eher durch Mimik zu beindrucken wusste, betont Chloë Grace Moretz ihre anfänglich verschlossene, später dann schon fast dämonische Körperhaltung, was insbesondere im Finale für eindrucksvolle Bilder sorgt.
Auch Julianne Moore weiß zu begeistern und bekommt als Margaret White glücklicherweise deutlich mehr Leinwandzeit zugesprochen als Piper Laurie in der 76er-Version. Moores Margaret ist nicht nur eine religiöse Fanatikerin, sondern eine durchaus liebende Mutter mit wahren Gefühlen für ihre Tochter, die sich aus ihrem Wahn jedoch nicht befreien kann. Eine hin und her gerissene Psychopathin, die von Julianne Moore gewohnt fantastisch gespielt wird.
 Nein, bezogen auf die Darsteller muss sich die Neuverfilmung nicht vor dem Original verstecken. Und auch die Inszenierung, die größeren Wert auf den Mutter-Tochter-Konflikt legt, geht prinzipiell in Ordnung. Leider übertreibt es Regisseurin Kimberly Peirce jedoch etwas bei den Effekten, was nicht zuletzt den heutigen Sehgewohnheiten geschuldet sein dürfte. Carrie setzt ihre telekinetischen Fähigkeiten nicht nur weitaus häufiger ein als noch im Original, auch fallen die Ergebnisse während ihres Rachefeldzugs deutlich expliziter aus. Zu einem Splatterfest verkommt der Film glücklicherweise zwar nie, doch auf die eine oder andere optische Spielerei hätte durchaus verzichtet werden dürfen.
Nein, bezogen auf die Darsteller muss sich die Neuverfilmung nicht vor dem Original verstecken. Und auch die Inszenierung, die größeren Wert auf den Mutter-Tochter-Konflikt legt, geht prinzipiell in Ordnung. Leider übertreibt es Regisseurin Kimberly Peirce jedoch etwas bei den Effekten, was nicht zuletzt den heutigen Sehgewohnheiten geschuldet sein dürfte. Carrie setzt ihre telekinetischen Fähigkeiten nicht nur weitaus häufiger ein als noch im Original, auch fallen die Ergebnisse während ihres Rachefeldzugs deutlich expliziter aus. Zu einem Splatterfest verkommt der Film glücklicherweise zwar nie, doch auf die eine oder andere optische Spielerei hätte durchaus verzichtet werden dürfen.
Nichtsdestoweniger ist „Carrie“ eine durchaus gelungene Neuverfilmung des Stephen-King-Klassikers, die dezent andere Schwerpunkte setzt und dadurch auch für Fans des Originals einen Blick wert ist.
Mein Fazit
Düsteres Horrordrama mit zwei fantastischen Hauptdarstellerinnen, einem packenden Finale und gelungenen Effekten, die leider ein wenig zu häufig zum Einsatz kommen.
Meine Wertung: 7/10
 Ruhig geworden in meinem Blog es ist. Und einen Grund dafür es gibt. Unglaublich, aber wahr: Ich war knapp vier Wochen lang nicht im Kino. Doch keine Angst, ich lebe noch. Und es geht mir gut. Ich hatte in letzter Zeit lediglich mehr Lust auf Videospiele als auf Kinofilme. Doch in den letzten vier Tagen war ich endlich wieder fleißig und habe insgesamt vier Filme geschaut, zu denen es nun nach und nach die dazugehörigen Reviews geben wird. Los geht’s mit „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ …
Ruhig geworden in meinem Blog es ist. Und einen Grund dafür es gibt. Unglaublich, aber wahr: Ich war knapp vier Wochen lang nicht im Kino. Doch keine Angst, ich lebe noch. Und es geht mir gut. Ich hatte in letzter Zeit lediglich mehr Lust auf Videospiele als auf Kinofilme. Doch in den letzten vier Tagen war ich endlich wieder fleißig und habe insgesamt vier Filme geschaut, zu denen es nun nach und nach die dazugehörigen Reviews geben wird. Los geht’s mit „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ … Meine Meinung
Meine Meinung Doch versteht mich bitte nicht falsch, „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ ist kein Totalausfall. Der Film ist sogar äußerst unterhaltsam. Die Action wurde spektakulär inszeniert, ist tricktechnisch auf dem neuesten Stand und bietet einige wirklich beeindruckende Schauwerte. Der Humoranteil wurde deutlich ausgebaut und bietet genau die richtige Mischung aus Spider-Mans typischen Albernheiten und gelungener Situationskomik. Die Darsteller, allen voran natürlich Andrew Garfield als Peter Parker und Emma Stone als Gwen Stacy, passen nach wie vor wie die Faust aufs Auge. Und dank seiner zahlreichen Handlungsstränge und Nebenkriegsschauplätze ist sichergestellt, dass immer irgendwo irgendwas passiert und der Film trotz seiner Laufzeit nie langweilig wird.
Doch versteht mich bitte nicht falsch, „The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro“ ist kein Totalausfall. Der Film ist sogar äußerst unterhaltsam. Die Action wurde spektakulär inszeniert, ist tricktechnisch auf dem neuesten Stand und bietet einige wirklich beeindruckende Schauwerte. Der Humoranteil wurde deutlich ausgebaut und bietet genau die richtige Mischung aus Spider-Mans typischen Albernheiten und gelungener Situationskomik. Die Darsteller, allen voran natürlich Andrew Garfield als Peter Parker und Emma Stone als Gwen Stacy, passen nach wie vor wie die Faust aufs Auge. Und dank seiner zahlreichen Handlungsstränge und Nebenkriegsschauplätze ist sichergestellt, dass immer irgendwo irgendwas passiert und der Film trotz seiner Laufzeit nie langweilig wird. Und dennoch ist der Film nicht viel mehr als ein Sammelsurium vieler gelungener Einzelszenen, die für sich betrachtet durchaus unterhaltsam und interessant sind, aber leider niemals so recht ineinander greifen und ein großes Ganzes ergeben wollen. Ich hoffe, dass der für 2016 bereits angekündigte „The Amazing Spider-Man 3“ eine bessere Mischung findet.
Und dennoch ist der Film nicht viel mehr als ein Sammelsurium vieler gelungener Einzelszenen, die für sich betrachtet durchaus unterhaltsam und interessant sind, aber leider niemals so recht ineinander greifen und ein großes Ganzes ergeben wollen. Ich hoffe, dass der für 2016 bereits angekündigte „The Amazing Spider-Man 3“ eine bessere Mischung findet.
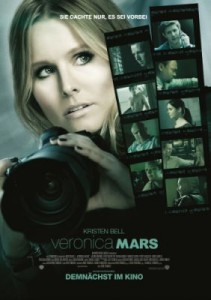 135,- Dollar. Das ist der Betrag, den ich im Rahmen der Kickstarter-Kampagne beigesteuert habe, um die Privatdetektivin Veronica Mars nach ihrem ungerechtfertigten Serien-Aus ins Kino zu bringen. 194,6 Kilometer. Das ist die Entfernung, die meine (glücklicherweise von Veronica ebenfalls begeisterte) bessere Hälfte und ich gestern zurückgelegt haben, um den Film auf der großen Leinwand zu sehen. Ob sich Investition und Fahrt gelohnt haben, erfahrt ihr … ach, was soll’s: Ja verdammt, es hat sich gelohnt!
135,- Dollar. Das ist der Betrag, den ich im Rahmen der Kickstarter-Kampagne beigesteuert habe, um die Privatdetektivin Veronica Mars nach ihrem ungerechtfertigten Serien-Aus ins Kino zu bringen. 194,6 Kilometer. Das ist die Entfernung, die meine (glücklicherweise von Veronica ebenfalls begeisterte) bessere Hälfte und ich gestern zurückgelegt haben, um den Film auf der großen Leinwand zu sehen. Ob sich Investition und Fahrt gelohnt haben, erfahrt ihr … ach, was soll’s: Ja verdammt, es hat sich gelohnt! Meine Meinung
Meine Meinung Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass „Veronica Mars“ nur für Fans genießbar wäre. Auch Neueinsteiger dürften mit der sympathischen Hauptfigur ihren Spaß haben. Zugegeben, der Mord an ihrer ehemaligen Klassenkameradin gehört nicht zu Veronicas stärksten Fällen, stellt aber ein solides, wenn auch nicht sonderlich spannendes Wer-hat’s-warum-getan-Rätsel-dar. Nichts zum Nägel kaufen, aber auch nichts zum Einschlafen. Viel wichtiger als des Rätsels Lösung ist ohnehin der Weg dorthin. Und dieser ist einmal mehr geprägt von Veronicas Spürsinn, gewitzten Ermittlungsmethoden nah an der Grenze der Legalität (und auch darüber hinaus) und natürlich zahlreichen bissigen Dialogen gepaart mit sarkastischer Schlagfertigkeit. Nein, um diese kurzweilige Kombination aus Krimi und Komödie genießen zu können, muss man glücklicherweise weder ein langjähriger Fan der Serie noch ein Fan speziell von Kristen Bell sein.
Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass „Veronica Mars“ nur für Fans genießbar wäre. Auch Neueinsteiger dürften mit der sympathischen Hauptfigur ihren Spaß haben. Zugegeben, der Mord an ihrer ehemaligen Klassenkameradin gehört nicht zu Veronicas stärksten Fällen, stellt aber ein solides, wenn auch nicht sonderlich spannendes Wer-hat’s-warum-getan-Rätsel-dar. Nichts zum Nägel kaufen, aber auch nichts zum Einschlafen. Viel wichtiger als des Rätsels Lösung ist ohnehin der Weg dorthin. Und dieser ist einmal mehr geprägt von Veronicas Spürsinn, gewitzten Ermittlungsmethoden nah an der Grenze der Legalität (und auch darüber hinaus) und natürlich zahlreichen bissigen Dialogen gepaart mit sarkastischer Schlagfertigkeit. Nein, um diese kurzweilige Kombination aus Krimi und Komödie genießen zu können, muss man glücklicherweise weder ein langjähriger Fan der Serie noch ein Fan speziell von Kristen Bell sein. Dieser sollte man jedoch sein, um den Film als Gesamtwerk und Fanservice würdigen zu können. Denn „Veronica Mars“ enthält so viele Gastauftritte, Anspielungen und Insiderwitze, dass man ihn vermutlich mehrmals sehen muss, um nichts zu verpassen. Von der Kickstarter-Finanzierung des Films über die leider nie gedrehte vierte Staffel bis hin zu Anspielungen auf Kristen Bells Schwangerschaft wurde so ziemlich alles in den Film gepackt, was irgendwie sinnvoll (oder auch weniger sinnvoll) verwendet werden konnte. Hinzu gesellen sich zahlreiche, teilweise nur wenige Sekunden lange Gastauftritte, bei denen es, so viel sei verraten, nicht verkehrt ist, sich mit Kristens Familienverhältnissen auszukennen. Als Fan sitzt man dabei freudestrahlend in seinem Kinosessel und kichert von Minute zu Minute zufriedener in sich hinein, während Außenstehende sich vermutlich fragen dürften, ob die letzten Sekunden irgendeine tiefere Bedeutung hatten.
Dieser sollte man jedoch sein, um den Film als Gesamtwerk und Fanservice würdigen zu können. Denn „Veronica Mars“ enthält so viele Gastauftritte, Anspielungen und Insiderwitze, dass man ihn vermutlich mehrmals sehen muss, um nichts zu verpassen. Von der Kickstarter-Finanzierung des Films über die leider nie gedrehte vierte Staffel bis hin zu Anspielungen auf Kristen Bells Schwangerschaft wurde so ziemlich alles in den Film gepackt, was irgendwie sinnvoll (oder auch weniger sinnvoll) verwendet werden konnte. Hinzu gesellen sich zahlreiche, teilweise nur wenige Sekunden lange Gastauftritte, bei denen es, so viel sei verraten, nicht verkehrt ist, sich mit Kristens Familienverhältnissen auszukennen. Als Fan sitzt man dabei freudestrahlend in seinem Kinosessel und kichert von Minute zu Minute zufriedener in sich hinein, während Außenstehende sich vermutlich fragen dürften, ob die letzten Sekunden irgendeine tiefere Bedeutung hatten. Bei aller Euphorie als Fan muss allerdings selbst ich zugeben, dass der Film zuweilen ein wenig überladen wirkt. So sehr es mich auch freut, dass versucht wurde, so viele Serienfiguren wie möglich in dem Film unterzubringen, so wenig kann ich leugnen, dass deren Auftritte teilweise den Eindruck hinterlassen, als wären die Figuren nur der Vollständigkeit halber dabei. Und einige offen bleibende Handlungsstränge jenseits des Mordfalls erwecken durchaus den Eindruck, als würde hier schon auf einen weiteren Film oder gar eine neue Serienstaffel hingearbeitet werden. Aber sei’s drum, dem Spaß am Film tut dies keinen echten Abbruch.
Bei aller Euphorie als Fan muss allerdings selbst ich zugeben, dass der Film zuweilen ein wenig überladen wirkt. So sehr es mich auch freut, dass versucht wurde, so viele Serienfiguren wie möglich in dem Film unterzubringen, so wenig kann ich leugnen, dass deren Auftritte teilweise den Eindruck hinterlassen, als wären die Figuren nur der Vollständigkeit halber dabei. Und einige offen bleibende Handlungsstränge jenseits des Mordfalls erwecken durchaus den Eindruck, als würde hier schon auf einen weiteren Film oder gar eine neue Serienstaffel hingearbeitet werden. Aber sei’s drum, dem Spaß am Film tut dies keinen echten Abbruch. Schon wieder habe ich mit meinem Filmtipp richtig gelegen! Ich denke, so langsam sollte ich über eine Karriere bei AstroTV nachdenken. Zumindest als Hellseher für Sneak-Previews hätte ich gute Chancen auf treffsichere Zukunftsaussagen. Nur ob ich davon leben könnte? Ich tue mich gerade etwas schwer damit, den Markt leichtgläubiger Kinogänger, die bereit wären, Geld für meine Vorhersagen auszugeben, realistisch einzuschätzen. Vielleicht bleibe ich doch lieber bei meinem jetzigen Job. Und konzentriere mich nun auf meine Review zu „Non-Stop“ …
Schon wieder habe ich mit meinem Filmtipp richtig gelegen! Ich denke, so langsam sollte ich über eine Karriere bei AstroTV nachdenken. Zumindest als Hellseher für Sneak-Previews hätte ich gute Chancen auf treffsichere Zukunftsaussagen. Nur ob ich davon leben könnte? Ich tue mich gerade etwas schwer damit, den Markt leichtgläubiger Kinogänger, die bereit wären, Geld für meine Vorhersagen auszugeben, realistisch einzuschätzen. Vielleicht bleibe ich doch lieber bei meinem jetzigen Job. Und konzentriere mich nun auf meine Review zu „Non-Stop“ … Meine Meinung
Meine Meinung Auch wenn die Auflösung ein wenig hanebüchen daherkommt (keine Angst: so absurd wie in „Flight Plan“ wird es glücklicherweise zu keiner Zeit), überzeugt „Non-Stop“ mit seinem interessanten Ausgangspunkt, einer von Anfang bis Ende äußerst straffen Inszenierung und geschickt platzierten falschen Fährten. Und natürlich mit Liam Neeson, der den mürrischen Einzelgänger inzwischen aus dem Effeff beherrscht, in den wenigen Actionszenen körperlich nach wie vor eine gute Figur macht und schlicht eine coole Sau ist, die das Publikum mit nur einem störrischen Blick zum Schmunzeln bringt. Schmunzeln dürft ihr in „Non-Stop“ übrigens öfter, denn trotz der durchaus ernsten Thematik nimmt sich der Film erfreulicherweise nur so ernst wie absolut nötig und lockert das Geschehen immer mal wieder mit ironischen Situationen und flapsigen Dialogen auf.
Auch wenn die Auflösung ein wenig hanebüchen daherkommt (keine Angst: so absurd wie in „Flight Plan“ wird es glücklicherweise zu keiner Zeit), überzeugt „Non-Stop“ mit seinem interessanten Ausgangspunkt, einer von Anfang bis Ende äußerst straffen Inszenierung und geschickt platzierten falschen Fährten. Und natürlich mit Liam Neeson, der den mürrischen Einzelgänger inzwischen aus dem Effeff beherrscht, in den wenigen Actionszenen körperlich nach wie vor eine gute Figur macht und schlicht eine coole Sau ist, die das Publikum mit nur einem störrischen Blick zum Schmunzeln bringt. Schmunzeln dürft ihr in „Non-Stop“ übrigens öfter, denn trotz der durchaus ernsten Thematik nimmt sich der Film erfreulicherweise nur so ernst wie absolut nötig und lockert das Geschehen immer mal wieder mit ironischen Situationen und flapsigen Dialogen auf. All dies macht aus „Non-Stop“ einen zwar nicht anspruchsvollen, dafür aber umso sympathischeren und extrem kurzweiligen Gute-Laune-Thriller, irgendwo zwischen „Taken“, „Flight Plan“ und „Snakes On A Plane“. Damit ist „Non-Stop“ genau das Richtige für einen entspannten und befriedigenden Filmabend nach Feierabend. Wirklich bedauerlich ist eigentlich nur, dass am Ende zwei, drei Handlungslücken offen bleiben und Julianne Moore in ihrer Rolle trotz Verdachtsmomente und persönlichem Schicksal ein wenig verschenkt wirkt …
All dies macht aus „Non-Stop“ einen zwar nicht anspruchsvollen, dafür aber umso sympathischeren und extrem kurzweiligen Gute-Laune-Thriller, irgendwo zwischen „Taken“, „Flight Plan“ und „Snakes On A Plane“. Damit ist „Non-Stop“ genau das Richtige für einen entspannten und befriedigenden Filmabend nach Feierabend. Wirklich bedauerlich ist eigentlich nur, dass am Ende zwei, drei Handlungslücken offen bleiben und Julianne Moore in ihrer Rolle trotz Verdachtsmomente und persönlichem Schicksal ein wenig verschenkt wirkt … Achtung, wichtige Warnung: Aufgrund akuter Müdigkeit zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Review kann der nun folgende Text Spuren von zusammenhanglosen Sätzen und wirrem Geschreibsel enthalten. Ich bitte dies zu entschulddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd … bin wach! Bin wach!
Achtung, wichtige Warnung: Aufgrund akuter Müdigkeit zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Review kann der nun folgende Text Spuren von zusammenhanglosen Sätzen und wirrem Geschreibsel enthalten. Ich bitte dies zu entschulddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd … bin wach! Bin wach! Meine Meinung
Meine Meinung Die gute Nachricht: An Chris Pine scheitert der Film definitiv nicht. Pines Darstellung ist engagiert, zuweilen überraschend vielschichtig und empfiehlt ihn durchaus für zukünftige Jack-Ryan-Abenteuer. Dasselbe gilt für Kevin Costner, der als väterlicher Mentor mit Rat und Tat zur Seite steht – wenn’s darauf ankommt, auch mit dem Gewehr im Anschlag. Auch Keira Knightley weiß (nicht nur optisch) zu gefallen, obgleich ihre Entwicklung von Jack Ryans misstrauischer Freundin hin zum unverzichtbaren Teammitglied arg unglaubwürdig und zuweilen unfreiwillig komisch wirkt. Doch das ist immer noch besser als Kenneth Branagh, der als russischer Bösewicht zwar solide aufspielt, jedoch zum reinen Abziehbild alter Feindbilder verkommt.
Die gute Nachricht: An Chris Pine scheitert der Film definitiv nicht. Pines Darstellung ist engagiert, zuweilen überraschend vielschichtig und empfiehlt ihn durchaus für zukünftige Jack-Ryan-Abenteuer. Dasselbe gilt für Kevin Costner, der als väterlicher Mentor mit Rat und Tat zur Seite steht – wenn’s darauf ankommt, auch mit dem Gewehr im Anschlag. Auch Keira Knightley weiß (nicht nur optisch) zu gefallen, obgleich ihre Entwicklung von Jack Ryans misstrauischer Freundin hin zum unverzichtbaren Teammitglied arg unglaubwürdig und zuweilen unfreiwillig komisch wirkt. Doch das ist immer noch besser als Kenneth Branagh, der als russischer Bösewicht zwar solide aufspielt, jedoch zum reinen Abziehbild alter Feindbilder verkommt. Und damit sind wir auch schon bei dem Grundproblem des Films angekommen: Er bietet nur altbekannte Kost. Und was noch schlimmer ist: Er verpackt diese nicht mal sonderlich gut. Die durchaus nicht uninteressante Geschichte wird pflichtbewusst, aber überraschungs- und leider auch recht spannungsarm vorangetrieben. Jacks Einbruch in Cherevins EDV-System, während selbiger von Cathy beim Abendessen abgelenkt wird, gehört sicherlich zu den besseren Momenten, lädt den genreerprobten Zuschauer aber auch nicht gerade zum Fingernägelkauen ein. Und die wenigen Actionszenen in Form kurzer Prügeleien, Schießereien und Verfolgungsjagden sind zwar solide inszeniert, zeigen aber auch nichts, was man nicht anderswo schon spektakulärer und vor allem packender gesehen hat.
Und damit sind wir auch schon bei dem Grundproblem des Films angekommen: Er bietet nur altbekannte Kost. Und was noch schlimmer ist: Er verpackt diese nicht mal sonderlich gut. Die durchaus nicht uninteressante Geschichte wird pflichtbewusst, aber überraschungs- und leider auch recht spannungsarm vorangetrieben. Jacks Einbruch in Cherevins EDV-System, während selbiger von Cathy beim Abendessen abgelenkt wird, gehört sicherlich zu den besseren Momenten, lädt den genreerprobten Zuschauer aber auch nicht gerade zum Fingernägelkauen ein. Und die wenigen Actionszenen in Form kurzer Prügeleien, Schießereien und Verfolgungsjagden sind zwar solide inszeniert, zeigen aber auch nichts, was man nicht anderswo schon spektakulärer und vor allem packender gesehen hat. Bevor ich mit meiner Review beginne, möchte ich die besinnliche Nachweihnachtszeit nutzen, um eine freundliche Bitte auszusprechen:
Bevor ich mit meiner Review beginne, möchte ich die besinnliche Nachweihnachtszeit nutzen, um eine freundliche Bitte auszusprechen: Worum geht’s
Worum geht’s Meine Meinung
Meine Meinung Wie bislang alle Teile der Reihe setzt auch „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ auf den inzwischen doch recht abgenutzt wirkenden Found-Footage-Stil und die für dieses Genre typischen Schreckmomente. Das mag vielleicht alles andere als innovativ sein, ist aber, zumindest den im Kinosaal schreienden Damen nach zu urteilen, offenbar immer noch höchst effektiv. Auch den langsamen Spannungsaufbau und das hektische Finale, in dem die Brücke zu den ersten drei Teilen der Reihe gespannt wird, teilt sich der Film mit seinen Vorgängern. Worin sich „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ jedoch unterscheidet, ist sein recht ausgeprägter Humor. Die erste Hälfte wirkt fast wie eine Komödie, was den Film nicht nur kurzweiliger werden lässt, sondern gleichzeitig dafür sorgt, dass einem die Figuren überraschend sympathisch sind und deren Schicksal einem nicht am Allerwertesten vorbei geht. „Paranormal Activity“ entwickelt sich also durchaus weiter. Zwar nur ein bisschen und in eine unerwartet lockere Richtung, aber genug, um der Reihe nach dem belanglosen vierten Teil wieder eine Chance zu geben!
Wie bislang alle Teile der Reihe setzt auch „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ auf den inzwischen doch recht abgenutzt wirkenden Found-Footage-Stil und die für dieses Genre typischen Schreckmomente. Das mag vielleicht alles andere als innovativ sein, ist aber, zumindest den im Kinosaal schreienden Damen nach zu urteilen, offenbar immer noch höchst effektiv. Auch den langsamen Spannungsaufbau und das hektische Finale, in dem die Brücke zu den ersten drei Teilen der Reihe gespannt wird, teilt sich der Film mit seinen Vorgängern. Worin sich „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“ jedoch unterscheidet, ist sein recht ausgeprägter Humor. Die erste Hälfte wirkt fast wie eine Komödie, was den Film nicht nur kurzweiliger werden lässt, sondern gleichzeitig dafür sorgt, dass einem die Figuren überraschend sympathisch sind und deren Schicksal einem nicht am Allerwertesten vorbei geht. „Paranormal Activity“ entwickelt sich also durchaus weiter. Zwar nur ein bisschen und in eine unerwartet lockere Richtung, aber genug, um der Reihe nach dem belanglosen vierten Teil wieder eine Chance zu geben! Mit „Carrie – Des Satans jüngste Tochter“ schuf Regisseur Brian De Palma 1976 eine der meiner Meinung nach besten Stephen-King-Verfilmungen aller Zeiten. Und einen Film, der aufgrund seiner zeitlosen Geschichte auch heute noch ohne große Abstriche hervorragend funktioniert. Morgen startet die mit Chloë Grace Moretz und Julianne Moore prominent besetzte Neuverfilmung in unseren Kinos. Ob sich der Kinobesuch lohnt oder ihr euer Geld lieber in die frisch erschienene Blu-ray des Originals investieren solltet, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest …
Mit „Carrie – Des Satans jüngste Tochter“ schuf Regisseur Brian De Palma 1976 eine der meiner Meinung nach besten Stephen-King-Verfilmungen aller Zeiten. Und einen Film, der aufgrund seiner zeitlosen Geschichte auch heute noch ohne große Abstriche hervorragend funktioniert. Morgen startet die mit Chloë Grace Moretz und Julianne Moore prominent besetzte Neuverfilmung in unseren Kinos. Ob sich der Kinobesuch lohnt oder ihr euer Geld lieber in die frisch erschienene Blu-ray des Originals investieren solltet, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest … Meine Meinung
Meine Meinung Nein, bezogen auf die Darsteller muss sich die Neuverfilmung nicht vor dem Original verstecken. Und auch die Inszenierung, die größeren Wert auf den Mutter-Tochter-Konflikt legt, geht prinzipiell in Ordnung. Leider übertreibt es Regisseurin Kimberly Peirce jedoch etwas bei den Effekten, was nicht zuletzt den heutigen Sehgewohnheiten geschuldet sein dürfte. Carrie setzt ihre telekinetischen Fähigkeiten nicht nur weitaus häufiger ein als noch im Original, auch fallen die Ergebnisse während ihres Rachefeldzugs deutlich expliziter aus. Zu einem Splatterfest verkommt der Film glücklicherweise zwar nie, doch auf die eine oder andere optische Spielerei hätte durchaus verzichtet werden dürfen.
Nein, bezogen auf die Darsteller muss sich die Neuverfilmung nicht vor dem Original verstecken. Und auch die Inszenierung, die größeren Wert auf den Mutter-Tochter-Konflikt legt, geht prinzipiell in Ordnung. Leider übertreibt es Regisseurin Kimberly Peirce jedoch etwas bei den Effekten, was nicht zuletzt den heutigen Sehgewohnheiten geschuldet sein dürfte. Carrie setzt ihre telekinetischen Fähigkeiten nicht nur weitaus häufiger ein als noch im Original, auch fallen die Ergebnisse während ihres Rachefeldzugs deutlich expliziter aus. Zu einem Splatterfest verkommt der Film glücklicherweise zwar nie, doch auf die eine oder andere optische Spielerei hätte durchaus verzichtet werden dürfen.