17. März 2013 |
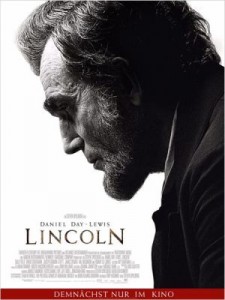 Worum geht’s
Worum geht’s
Kurz vor dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges möchte der frisch wiedergewählte Präsident Abraham Lincoln seine Popularität nutzen, um die Sklaverei über einen Verfassungszusatz endgültig abzuschaffen. Um diesen Verfassungszusatz im Repräsentantenhaus zu verabschieden, benötigt Lincoln jedoch nicht nur die Stimmen seiner eigenen Partei, sondern auch mehrere Abweichler in den Reihen seines politischen Gegners. Viel Zeit für Überzeugungsarbeit bleibt Lincoln nicht, denn das Ende des Krieges rückt immer näher. Und eben dieser Krieg dient Lincoln als Argument für die Abschaffung der Sklaverei …
Meine Meinung
Steven Spielbergs „Lincoln“ beschäftigt sich ausschließlich mit den letzten Monaten im Leben des titelgebenden Präsidenten und ist somit weniger als Biografie, sondern vielmehr als politisches Kammerspiel und Plädoyer für die Menschenrechte zu betrachten. Zwar wird auch die private Seite Lincolns immer mal wieder angerissen, doch das Hauptaugenmerk liegt auf den politischen Diskussionen und auf den taktischen Entscheidungen, die notwendig waren, um die Abschaffung der Sklaverei durchzusetzen. Leider muss ich zugeben, dass ich mir eben diese zu treffenden Entscheidungen spannender inszeniert und die Diskussionen packender und emotionaler vorgestellt bzw. erhofft hatte. Die Dialoge sind zwar interessant und durchaus fordernd, bleiben aber überraschend nüchtern und wirken zuweilen etwas distanziert. Wirklich fesseln konnte mich das Geschehen dementsprechend nicht, obwohl ich für dialoglastige Filme durchaus zu haben bin (das Justizdrama „Die zwölf Geschworenen“ gehört nicht ohne Grund zu meinen Lieblingsfilmen). In Verbindung mit der Laufzeit von 150 Minuten entstanden so mehrere Situationen, in denen sich mein Blick von der Leinwand löste und vorsichtig gen Uhr wanderte.
An den Darstellern hingegen lässt sich nichts, aber wirklich gar nichts kritisieren. Daniel Day-Lewis zeigt einmal mehr eine beeindruckende Leistung, dasselbe gilt für Sally Field, David Strathairn und in besonderem Maße für Tommy Lee Jones als Thaddeus Stevens, dessen Motivation erst am Ende des Films erklärt wird, dafür aber genau die Menschlichkeit in die Geschichte bringt, die der Film sonst größtenteils vermissen lässt.
Meine Wertung: 6/10
Zum Schluss noch eine kurze persönliche bzw. politische Anmerkung: Ich finde es äußerst erschreckend, wie stark mich der Film in einzelnen Szenen an die derzeit in Deutschland geführte Diskussion über die rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare erinnert hat. So fällt z.B. in einer Szene (sinngemäß) der Satz „Ich habe nichts gegen Neger, aber deswegen möchte ich ihnen nicht das Recht der Wahl zusprechen.“, bei dem ich sofort an mehrere Unionspolitiker („Ich habe nichts gegen Homosexuelle, aber dieselben Rechte wie Heterosexuelle sollen sie auch nicht haben.“) denken musste. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns …
3. März 2013 |
 Endlich habe auch ich ihn gesehen. DEN Pflichtfilm des Kinojahres 2012. DEN Gute-Laune-Film schlechthin. DEN Film, den man einfach mögen muss und nach dem man mit einem Lächeln im Gesicht durch die Welt wandert (bzw. rollt). Die Rede ist selbstverständlich von dem französischen Überraschungserfolg „Ziemlich beste Freunde“. Bevor ihr euch jetzt auf eine weitere Lobeshymne einstellt, schreibe ich lieber gleich, dass mich der Film leider alles andere als überzeugt hat. Wieso, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest …
Endlich habe auch ich ihn gesehen. DEN Pflichtfilm des Kinojahres 2012. DEN Gute-Laune-Film schlechthin. DEN Film, den man einfach mögen muss und nach dem man mit einem Lächeln im Gesicht durch die Welt wandert (bzw. rollt). Die Rede ist selbstverständlich von dem französischen Überraschungserfolg „Ziemlich beste Freunde“. Bevor ihr euch jetzt auf eine weitere Lobeshymne einstellt, schreibe ich lieber gleich, dass mich der Film leider alles andere als überzeugt hat. Wieso, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest …
Worum geht’s
Um dem Arbeitsamt gegenüber zu belegen, dass er auf Arbeitssuche ist, bewirbt sich der frisch aus dem Gefängnis entlassene Driss (Omar Sy) bei dem Millionär Philippe (François Cluzet) um einen Job als Pfleger. Philippe ist seit einem Paragliding-Unfall vom Hals abwärts gelähmt und daher stets auf fremde Hilfe angewiesen. Obwohl Driss keine Qualifikationen vorweisen kann, sich Philippe gegenüber äußerst respektlos verhält und klarstellt, dass es ihm lediglich um die Bescheinigung für das Arbeitsamt geht, bekommt er den Job. Philippe ist es leid, ständig bemitleidet zu werden und sieht in Driss einen Mann, der ihn wie einen Menschen und nicht wie einen Pflegefall behandelt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, die die ungleichen Männer nachhaltig verändert …
Meine Meinung
Es hätte so schön werden können. Man nehme ein ernstes Thema wie Querschnittslähmung und zwei höchst unterschiedliche Menschen, die sich gegenseitig zurück ins Leben führen. Dazu ein wenig Humor, ein Prise Sozialkritik und zwei so sympathische wie begabte Hauptdarsteller – fertig ist die Erfolgsdramödie. Und oberflächlich betrachtet ist „Ziemlich beste Freunde“ tatsächlich eben dieser schöne Film mit seiner überall hoch gelobten lebensbejahenden Botschaft, den man von den Kindern bis hin zu den Großeltern jeder Generation bedenkenlos empfehlen kann. Wie gesagt, oberflächlich betrachtet.
Beginnt man jedoch über den Film nachzudenken, offenbaren sich zahlreiche Mängel. Es beginnt schon mit den stereotypen Figuren, wie sie einfacher gestrickt nicht sein könnten. Auf der einen Seite der reiche Intellektuelle, kultiviert, eloquent, mit einer Vorliebe für klassische Musik – und natürlich weißer Hautfarbe. Auf der anderen Seite der mittellose Kleinkriminelle, ungebildet, sexistisch, stets dicke Hip-Hop-Kopfhörer tragend – und natürlich dunkler Hautfarbe. Unnötig zu erwähnen, dass Driss‘ Eingliederung in die Gesellschaft mit zunehmender Bildung einher geht. In mehreren Reviews wurde dem Film gar unterschwelliger Rassismus unterstellt. Und auch wenn ich zugeben muss, dass Driss‘ Charakterisierung und spätere „Kultivierung“ durchaus einen faden Beigeschmack bei mir hinterlassen haben, würde ich so weit nicht gehen wollen. Allerdings werfe ich dem Film vor, dass er alle klischeebeladenen Mittel nutzt, um auch dem letzten Zuschauer klarzumachen, für welche soziale Schicht die beiden Männer jeweils stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies auch geschickter und weit weniger offensichtlich hätte geschehen können.
Weiter geht’s mit dem Thema Querschnittslähmung und deren Auswirkungen auf die Betroffenen. Den Film diesbezüglich als oberflächlich zu bezeichnen, wäre noch geschmeichelt. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich besser nicht fragen sollte, ob die Geschichte samt ihrer Botschaft auch mit einem mittellosen Querschnittgelähmten funktionieren würde, blendet der Film sämtliche Unannehmlichkeiten aus, die den Zuschauer belasten könnten. Der sicherlich alles andere als einfache Arbeitsalltag des Pflegers Driss wird mit einem Dialog über Darmentleerung weggewitzelt und die Selbstmordgedanken des gelähmten Philippe in einem Satz nebenbei abgefrühstückt. Auf diese Art und Weise bleibt der Film in seiner Stimmung zwar durchweg positiv, leidet gleichzeitig jedoch unter seiner klinisch reinen Oberflächlichkeit und fehlender Glaubwürdigkeit.
Abschließend noch ein zwei Sätze zum Humor des Films. Witze über Behinderte sind im Kino eher selten und wirken dadurch in einem Film wie „Ziemlich beste Freunde“ frech und provokant. Zumindest auf Menschen, die sich sonst stets politisch korrekt verhalten und Zynismus nur vom Hörensagen kennen. Zugegeben, ein paar Schmunzler sind dabei, doch auf Dauer wiederholen sich die Witze auf Kosten Philippes Behinderung und Driss‘ mangelnder Kultiviertheit, so dass der anfänglich frisch wirkende Humor mich schon bald zu langweilen begann. Ein wenig mehr Abwechslung beim Humor hätte dem Film wahrlich nicht geschadet.
Mein Fazit
Toll gespielter Gute-Laune-Film mit sympathischer Botschaft, der jedoch erschreckend oberflächlich bleibt und kein einziges Klischee auslässt.
Meine Wertung: 5/10
25. Februar 2013 |
 So langsam werde ich müde. Wer mir bei Twitter folgt (oder einen Blick auf den Kalender wirft und eins und eins zusammenzählt), weiß auch, wieso. Richtig, ich habe mir in der letzten Nacht statt zu schlafen die Oscar-Verleihung angeschaut. Und erfreue mich nun an einem Tag Urlaub – den ich als alter Mann nach einer Nacht ohne Schlaf auch dringend benötige. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Nein, heute beschäftige ich mich mit dem Filmklassiker „Casablanca“, einen der wohl am häufigsten zitierten Filme überhaupt. In diesem Sinne: Schau mir in die Review, Kleines!
So langsam werde ich müde. Wer mir bei Twitter folgt (oder einen Blick auf den Kalender wirft und eins und eins zusammenzählt), weiß auch, wieso. Richtig, ich habe mir in der letzten Nacht statt zu schlafen die Oscar-Verleihung angeschaut. Und erfreue mich nun an einem Tag Urlaub – den ich als alter Mann nach einer Nacht ohne Schlaf auch dringend benötige. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Nein, heute beschäftige ich mich mit dem Filmklassiker „Casablanca“, einen der wohl am häufigsten zitierten Filme überhaupt. In diesem Sinne: Schau mir in die Review, Kleines!
Worum geht’s
Während des zweiten Weltkrieges versuchen zahlreiche Flüchtlinge, aus den von den Nazis besetzten Ländern nach Amerika überzusiedeln. Der einzig sichere Hafen liegt in Lissabon, doch ist dieser nur noch schwer zu erreichen. Eine der wenigen Möglichkeiten stellt die im neutralen Marokko gelegene Stadt Casablanca dar. Hier betreibt der zynische Amerikaner Rick Blaine (Humphrey Bogart) eine Bar, die als Treffpunkt für Flüchtlinge auf der Suche nach Ausreisepapieren gilt. Rick selbst hält sich stets aus allen illegalen Geschäften raus. Diese Einstellung und die regelmäßigen Roulette-Gewinne des französischen Polizeichefs Captain Louis Renault (Claude Rains) sichern ihm ein ruhiges Leben und profitable Gewinne. Eines Abends betreten der von den Nazis gesuchte Widerstandskämpfer Victor Laszlo (Paul Henreid) und dessen Frau Ilsa Lund (Ingrid Bergman) Ricks Bar. Die beiden benötigen dringend einen Flug nach Lissabon, da die Nazis ihnen bereits auf den Fersen sind. Was Victor nicht ahnt: Rick und Ilsa haben eine gemeinsame Vergangenheit …
Meine Meinung
Das ist er also, DER große Klassiker, den jeder Filmfan gesehen haben sollte. Aus historischer Sicht betrachtet, stimme ich dem sogar zu, doch wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich der Film selbst ein kleines bisschen enttäuscht. Zugegeben, Humphrey Bogarts zynische Kommentare sowie seine überheblichen Sprüche sind eine Klasse für sich. Der von Claude Rains hervorragend gespielte schlitzohrige Polizeichef ist herrlich undurchsichtig und gleichzeitig für viele Schmunzler gut. Und die Geschichte ist an Tragik und Dramatik nur schwer zu überbieten und überrascht im berühmten und durchaus spannenden Finale am Flughafen sogar mit der einen oder anderen unerwarteten Wendung.
Dennoch hat mir etwas gefehlt. Und zwar ausgerechnet die Leidenschaft, von der im Zusammenhang mit „Casablanca“ zwar oft gesprochen wird, von der im Film selbst jedoch nur selten auch wirklich etwas zu spüren ist. Viel zu emotionslos wirkt der Umgang der Figuren miteinander, als dass ich von großen Gefühlen sprechen mag, die sich da vor mir auf dem Fernseher abspielten. Lediglich Ingrid Bergman schaffte es zeitweise, mich davon zu überzeugen, dass hier so etwas wie Liebe im Spiel ist. Humphrey Bogart und Paul Henreid hingegen wirkten auf mich viel zu sachlich und ihre, zum Glück niemals schwülstigen, Liebesschwüre dadurch letztlich unglaubwürdig. Die an sich ergreifende Dreiecksgeschichte und insbesondere die eigentlich tragische Abschiedsszene ließen mich dadurch leider völlig kalt.
Dennoch bin ich froh, „Casablanca“ endlich gesehen zu haben. Nicht nur, weil ich nun endlich den Ursprung zahlloser Zitate und Anspielungen kenne. Auch nicht, weil ich nun weiß, dass es nicht „Schau mir in die Augen, Kleines“, sondern je nach Synchronfassung „Ich schau“ bzw. „Ich seh dir in die Augen, Kleines“ heißt. Nein, ich bin froh, weil „Casablanca“ trotz seiner Schwächen ein guter Film und eine gelungene Mischung aus tragischer Romanze und patriotischem Spionagethriller ist, die einen interessanten Blick auf die damalige Zeit ermöglicht.
Mein Fazit
Ein zynischer Protagonist, gelungene Dialoge, ein wenig Spionage, viel Tragik und eine große Liebe – von der im Film leider nur wenig zu spüren ist. „Casablanca“ vereint gekonnt mehrere Genres in sich und ist stets interessant, bleibt letztlich aber zu kühl, um wirklich zu fesseln.
Meine Wertung: 7/10
17. Februar 2013 |
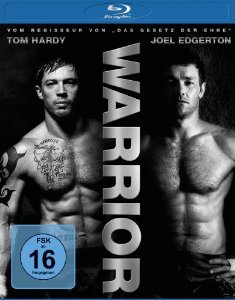 Es gibt Filme, die nicht unbedingt ins Kino gehören. Weil sie durchschnittlich sind. Weil sie Massenware sind. Weil sie nichts Besonderes sind. Und die es dann dennoch irgendwie ins Kino schaffen. Und es gibt Filme, die eindeutig auf die große Leinwand gehören. Und die dort, aus was für Gründen auch immer, nie ankommen. Das hervorragende Kampfsportdrama „Warrior“ ist einer dieser Filme …
Es gibt Filme, die nicht unbedingt ins Kino gehören. Weil sie durchschnittlich sind. Weil sie Massenware sind. Weil sie nichts Besonderes sind. Und die es dann dennoch irgendwie ins Kino schaffen. Und es gibt Filme, die eindeutig auf die große Leinwand gehören. Und die dort, aus was für Gründen auch immer, nie ankommen. Das hervorragende Kampfsportdrama „Warrior“ ist einer dieser Filme …
Worum geht’s
Der inzwischen trockene Alkoholiker Paddy (Nick Nolte) führt ein einsames Leben. Zu seinen beiden Söhnen Brendan (Joel Edgerton) und Tommy (Tom Hardy) hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr. Und auch die Brüder selbst gehen seit ihrer Jugend getrennte Wege. Dies ändert sich, als Tommy nach 14 Jahren plötzlich vor seinem Vater steht und ihn bittet, ihn für ein hoch dotiertes Mixed-Martial-Arts-Turnier zu trainieren. Der ansonsten äußerst abweisend reagierende Tommy stellt klar, dass es ihm ausschließlich um das Training geht. Dennoch willigt Paddy, der sich eine Versöhnung mit seinem Sohn wünscht, ein. Auf dem Turnier treffen die beiden überraschend auf Brendan. Der ehemalige MMA-Kämpfer und jetzige Physiklehrer hatte aus Liebe zu seiner Frau vor Jahren mit dem Kämpfen aufgehört. Doch nun droht der jungen Familie aufgrund einer gescheiterten Finanzierung der Verlust des gemeinsamen Hauses. Und um das Eigenheim retten zu können, ist Brendan auf das Preisgeld dringend angewiesen …
Meine Meinung
Es ist wirklich eine Schande, dass dieser Film es nicht in die deutschen Kinosäle geschafft hat. Dabei bringt er alles mit, was ein gelungenes Kinoerlebnis ausmacht: Interessante Figuren, tolle Darsteller, eine ergreifende Geschichte und packende Action in Form erstklassiger Mixed-Martial-Arts-Kämpfe.
Bis es zu diesen Kämpfen kommt, vergeht allerdings eine Weile. Und das ist auch gut so. Die erste Stunde konzentriert sich, von zwei kurzen Einführungskämpfen abgesehen, auf die Figuren und deren angespannte Verhältnisse zueinander. Regisseur Gavin O’Connor lässt sich Zeit damit, Paddy, Brendan und Tommy vorzustellen. Nach und nach wird mehr aus dem jeweiligen Leben offenbart, wobei die Sympathien recht früh bei dem vorwärts gewandten Brendan liegen, während Tommy und Paddy eher Geiseln ihrer eigenen Vergangenheit sind, derer sie sich nicht entreißen können. Die Geschichte kommt dabei leider nicht ohne bekannte Strukturen und Klischees aus. Auch trägt sie ab und an einen Hauch zu dick auf und strapaziert die Nerven zuweilen mit etwas zu viel Pathos. Dennoch bleibt das Geschehen jederzeit glaubhaft und bereitet die Figuren sowie uns Zuschauer perfekt auf das anstehende Turnier vor.
Wenn dieses dann nach über einer Stunde Laufzeit beginnt und die ersten Kämpfe ausgetragen werden, offenbart sich, wie wichtig eine gelungene Charaktereinführung für einen Kampsportfilm doch ist. Ich habe lange nicht mehr so intensiv mitgefiebert wie mit den beiden ungleichen Brüdern. Und praktisch jeden Schlag, den sie einstecken müssen, am eigenen Körper gespürt. Genau so, wie es sein muss. Die Kämpfe sind allesamt hervorragend choreografiert, höchst abwechslungsreich gestaltet und schon beinahe unerträglich spannend. Auch wenn man tief im Inneren natürlich ahnt, wer das Turnier letztlich als Sieger verlässt.
Dass „Warrior“ so hervorragend funktioniert, ist jedoch nicht nur der einfühlsamen Geschichte und den packenden Kämpfen, sondern insbesondere den erstklassigen Darstellern geschuldet. Während Joel Edgerton als besonnen agierender Brendan einen echten Sympathieträger darstellt, überzeugt Tom Hardy mit innerlicher Zerrissenheit und physischer Präsenz. Eine Klasse für sich ist Nick Nolte, der den bereuenden und um Vergebung flehenden Vater erfreulich unaufdringlich spielt. Und uns Zuschauern einen der wohl emotionalsten Momente der jüngsten Filmvergangenheit beschert.
Mein Fazit
Hervorragendes Kampfsport-/Familiendrama mit erstklassigen Darstellern, glaubhaften Figuren, einer rührenden Geschichte und extrem packenden Kämpfen. Oder anders formuliert: Ein Film, den meiner Meinung nach jeder gesehen haben sollte!
Meine Wertung: 9/10
20. Januar 2013 |
 Wenn es etwas gibt, was ich an meiner CinemaxX GoldCard liebe, dann die Möglichkeit, Filme gucken zu können, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob der Film das Eintrittsgeld wirklich wert ist. Im schlimmsten Fall ist der Kinobesuch eine Zeitverschwendung, im besten die Entdeckung einer kleinen Filmperle. Meistens jedoch ist es weder das eine noch das andere, sondern einfach nur ein durchschnittlicher Film ohne große Ausreißer nach oben oder unten. Willkommen in dem Haus am Ende der Straße …
Wenn es etwas gibt, was ich an meiner CinemaxX GoldCard liebe, dann die Möglichkeit, Filme gucken zu können, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob der Film das Eintrittsgeld wirklich wert ist. Im schlimmsten Fall ist der Kinobesuch eine Zeitverschwendung, im besten die Entdeckung einer kleinen Filmperle. Meistens jedoch ist es weder das eine noch das andere, sondern einfach nur ein durchschnittlicher Film ohne große Ausreißer nach oben oder unten. Willkommen in dem Haus am Ende der Straße …
Worum geht’s
Die Ärztin Sarah (Elisabeth Shue) zieht mit ihrer Tochter Elissa (Jennifer Lawrence) in eine beschauliche Kleinstadt. Das luxuriöse Haus können sich die beiden nur leisten, da die Bewohner des Nachbarhauses vor vier Jahren brutal von ihrer 13-jährigen Tochter Carrie Anne ermordet wurden. Dass das psychisch labile Mädchen seitdem vermisst wird, macht die Wohnlage umso unattraktiver. Nun lebt in dem Haus nur noch Carrie Annes älterer Bruder Ryan (Max Thieriot), der seit dem Tod seiner Eltern ein Leben als Eigenbrötler fristet. Als Elissa auf dem Heimweg von einem Regenschauer überrascht wird, trifft sie zufällig auf Ryan, der sie nach Hause fährt. Schnell freundet sie sich mit dem sensiblen Jungen an, der offensichtlich stark unter der Familientragödie leidet. Doch im Keller seines Hauses bewahrt Ryan ein Geheimnis, welches sich für Elissa zur tödlichen Gefahr entwickelt …
 Meine Meinung
Meine Meinung
„House At The End Of The Street“ macht es mir nicht gerade einfach. Die erste Stunde, die weniger ein Thriller als vielmehr ein Außenseiterdrama ist, hat mir erstaunlich gut gefallen. Die Figuren sind zwar nicht besonders originell, aber durchaus sympathisch. Die Geschichte wird ruhig und in kleinen Schritten erzählt, ohne dabei zu langweilen. Und das Geheimnis des Hauses wird scheinbar recht früh aufgeklärt, was in mir die Hoffnung wachsen ließ, die Geschichte würde auf das typische Klischee-Ende verzichten. So weit so gut.
Doch dann kommt es zu dem so gar nicht überraschenden Plot Twist, den der geübte Kinogänger ohnehin von Anfang an vermutet hatte und auf den ich nur allzu gerne verzichtet hätte. Und schon geht es mit dem Film bergab. Nicht nur, dass sich „House At The End Of The Street“ zu einem komplett vorhersehbaren Thriller entwickelt (bzw. offenbart, dass es sich entgegen jeglicher Hoffnung die ganze Zeit um einen komplett vorhersehbaren Thriller gehandelt hat), mit fortschreitender Handlung öffnen sich auch immer größere Logiklöcher, die denkende Menschen nur schwer ignorieren können. Je mehr man über die Entwicklung der Geschichte grübelt, desto weniger Sinn ergibt sie. Doch nachdenken soll man zu diesem Zeitpunkt vermutlich ohnehin nicht mehr, sondern eher mit der rennenden und schreienden Jennifer Lawrence mitfiebern. Da auch das Finale komplett vorhersehbar bleibt, dürften jedoch nur Teenager ohne jegliche Thriller-Erfahrung so etwas wie Spannung verspüren. Alle anderen werden sich weder fragen, ob die Protagonistin überlebt, noch welche der Nebenfiguren das Ende des Films erleben, sondern lediglich bemüht aufmerksam auf den Abspann warten.
 Mein Fazit
Mein Fazit
„House At The End Of The Street“ ist ein durchschnittlich inszenierter Thriller, dessen einzige Überraschung darin besteht, dass er trotz guter Voraussetzungen keine einzige Überraschung bietet. Für Thriller-Frischlinge sicherlich keine totale Zeitverschwendung, aber beileibe auch kein Film für die Ewigkeit.
Meine Wertung: 5/10
Zum Schluss hier noch der Link zur offiziellen Filmseite und der Trailer:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=oQ6NxsxSwc8]
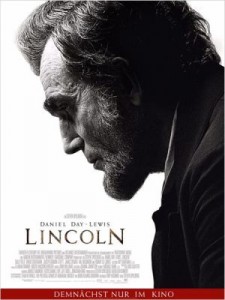 Worum geht’s
Worum geht’s


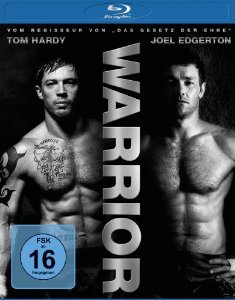
 Wenn es etwas gibt, was ich an meiner
Wenn es etwas gibt, was ich an meiner  Meine Meinung
Meine Meinung Mein Fazit
Mein Fazit