1. Mai 2017 |
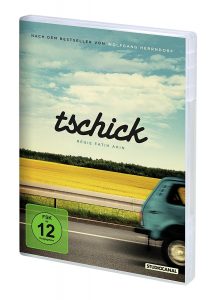 Ich geb’s zu: Der deutsche Film und ich, wir sind nicht so richtig kompatibel. Dementsprechend gibt es nur wenige deutsche Filme, die mir wirklich gut gefallen. Aaaaber, es gibt sie. „Das Experiment“, „Die Welle“, „Wir sind die Nacht“ oder auch „Die Nacht der lebenden Loser“ und „Fack ju Göhte“, um mal zwei weit weniger düstere Beispiele zu nennen. Nichtsdestoweniger langweilen mich die meisten deutschen Filme einfach nur. Ob dies nun daran liegt, dass die meisten Filme tatsächlich langweilig sind, oder meine Sehgewohnheiten schlicht zu sehr von amerikanischen Produktionen geprägt wurden, lasse ich mal dahingestellt. Viel wichtiger ist an dieser Stelle doch: Wo reiht sich Fatih Akins „Tschick“ ein?
Ich geb’s zu: Der deutsche Film und ich, wir sind nicht so richtig kompatibel. Dementsprechend gibt es nur wenige deutsche Filme, die mir wirklich gut gefallen. Aaaaber, es gibt sie. „Das Experiment“, „Die Welle“, „Wir sind die Nacht“ oder auch „Die Nacht der lebenden Loser“ und „Fack ju Göhte“, um mal zwei weit weniger düstere Beispiele zu nennen. Nichtsdestoweniger langweilen mich die meisten deutschen Filme einfach nur. Ob dies nun daran liegt, dass die meisten Filme tatsächlich langweilig sind, oder meine Sehgewohnheiten schlicht zu sehr von amerikanischen Produktionen geprägt wurden, lasse ich mal dahingestellt. Viel wichtiger ist an dieser Stelle doch: Wo reiht sich Fatih Akins „Tschick“ ein?
Worum geht’s
Der 14-jährige Maik (Tristan Göbel) hat es alles andere als leicht. Seine Mutter ist Alkoholikerin, sein Vater ein gewaltbereiter Blender mit einer Vorliebe für jüngere Frauen. In der Schule gilt Maik als Außenseiter und seine heimliche Liebe Tatjana (Aniya Wendel), das beliebteste Mädchen der Schule, nimmt ihn gar nicht erst zur Kenntnis. So kommt es auch, dass Maik nicht zu Tatjanas Geburtstagsparty eingeladen wird, obwohl er ihr extra ein Porträt gemalt hatte und ihr dieses als Geschenk überreichen wollte. Maiks neuer Klassenkamerad Andrej „Tschick“ Tschichatschow (Anand Batbileg), der ebenso ein Außenseiter ist, überredet ihn, Tatjana das Bild dennoch zu überreichen. In einem gestohlenen Lada fahren die beiden erst zu Tatjanas Party und danach in Richtung Walachei, um dort Tschicks Großvater zu besuchen …
Meine Meinung
Wie ich oben bereits schrieb, haben es deutsche Filme bei mir traditionell schwer. Was bei mir hingegen immer zieht, sind Filme über Außenseiter. Nicht zuletzt, weil auch ich in meiner Jugend ein Außenseiter war. Und es, wenn ich ehrlich bin, wohl auch immer noch bin. Folglich dürfte es niemanden verwundern, dass ich für entsprechende Figuren grundsätzlich Sympathien hege. Wenn Klassenschwarm Tatjana alle Mitschüler, bis auf Maik, zur Geburtstagsparty einlädt und dieser Tschicks Frage, wieso nicht auch er eingeladen ist, mit „Weil ich nun mal langweilig bin und scheiße aussehe.“ beantwortet, weiß ich recht genau, was in dieser Figur vorgeht. Denn auch wenn es objektiv betrachtet nicht stimmt, ändert es doch nichts daran, wie man sich in solchen Momenten fühlt. Umso wichtiger ist es, zu lernen, mit solchen Situationen umzugehen und zu erkennen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und sei es auf dem Beifahrersitz eines gestohlenen Ladas.
Und so ist Fatih Akins „Tschick“ einerseits ein typischer Coming-of-Age-Film in Form eines Roadmovies, in dem Jugendliche durch ein gemeinsames Abenteuer die Werte des Lebens lernen, andererseits aber auch ein Feel-Good-Movie voller Hoffnung und spaßiger Dialoge, die mich nicht nur schmunzeln, sondern teilweise auch laut lachen ließen. Witzig-absurde Szenen gehen Hand in Hand mit wehmütigen beziehungsweise nachdenklich stimmenden Szenen – und auch wenn der Film letztlich ein wenig oberflächlich bleibt, sorgt doch eben dieses Unbeschwerte dafür, dass man sich als Zuschauer stets wohl fühlt.
Besonders viel Freude hat mir Hauptdarsteller Tristan Göbel bereitet, der die Entwicklung seiner Figur Maik sehr nuanciert spielt und in nahezu allen Szenen eine tolle Leistung abliefert. Anand Batbileg geht als Tschick auch in Ordnung, während Mercedes Müller als Isa, die im Lauf der Fahrt hinzustößt, leider zu wenig Zeit hat, um dauerhaft in Erinnerung zu bleiben. Wirklich schade, da die Figur durchaus interessant ist, aber schlicht viel zu kurz in Erscheinung tritt.
Abschließend noch ein Wort zur DVD: Ich habe keine Ahnung, ob es an meiner Scheibe liegt, aber stellenweise zeigt das Bild bei mir starkes Flimmern und extrem heftige Muster. Insbesondere zu Beginn dachte ich, mein Fernseher sei kaputt. Falls ihr den Film ebenfalls auf DVD gesehen habt, könnt ihr mir ja mal verraten, ob euch so was auch aufgefallen ist. Würde mich wirklich interessieren …
Mein Fazit
So sympathischer wie kurzweiliger Jugendfilm mit tollen Darstellern, der genau das bietet, was man sich von einem gelungenen Coming-of-Age-Feel-Good-Roadmovie (jetzt gehen mir die Bindestriche aus) erhofft.
Meine Wertung: 8/10
27. Februar 2017 |
 Immer öfter höre oder lese ich, dass Horrorfilme heutzutage gar nicht mehr richtig gruselig wären. Gleichzeitig erlebe ich, dass besagte Horrorfilme bei Tageslicht auf einem kleinen Notebook-Bildschirm geschaut werden, während sich nebenbei unterhalten oder mit dem Smartphone gespielt wird (ja, das ist ein Extrembeispiel). Mal ehrlich, Leute: So kann ja auch keine unheimliche Atmosphäre aufkommen!
Immer öfter höre oder lese ich, dass Horrorfilme heutzutage gar nicht mehr richtig gruselig wären. Gleichzeitig erlebe ich, dass besagte Horrorfilme bei Tageslicht auf einem kleinen Notebook-Bildschirm geschaut werden, während sich nebenbei unterhalten oder mit dem Smartphone gespielt wird (ja, das ist ein Extrembeispiel). Mal ehrlich, Leute: So kann ja auch keine unheimliche Atmosphäre aufkommen!
Es gibt gewisse Regeln, die man beachten muss, um einen Horrorfilm zu genießen:
1. Enthalte dich jeder Form von Licht, Licht ist ungleich Atmosphäre.
2. Nicht reden und keine Smartphones. Das alles fällt unter Ablenkung, Ablenkung ist die Erweiterung von Nummer 1.
3. Du darfst nie, niemals, unter keinen Umständen denken „Es ist nur ein Film!“ – denn es ist nicht nur ein Film!
Ich zum Beispiel schaue Horrorfilme am liebsten alleine. Komplett im Dunkeln. Mit (guten) Kopfhörern, um nichts von der Außenwelt wahrzunehmen und wirklich komplett im Film zu versinken. Ihr würdet euch wundern, wie oft ich dadurch selbst bei durchschnittlichen Filmen zusammenzucke. Probiert es ruhig selbst mal so aus – oder habt ihr etwa … Angst?
Worum geht’s
Seit dem Tod ihres Mannes hält sich Alice Zander (Elizabeth Reaser) mit gefälschten Séancen mehr schlecht als recht als Medium über Wasser. Wackelnde Tische, ausgepustete Kerzen, unheimliche Schatten – gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Lina (Annalise Basso) und Doris (Lulu Wilson) stellt Alice scheinbar Kontakt zu Verstorbenen her, um den zahlenden Kunden das zu sagen, was sie hören möchten. Um ihre Darstellung ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten, nimmt Alice eines Tages ein Ouija-Brett hinzu. Mit überraschenden Folgen, denn plötzlich kann Doris tatsächlich mit der Geisterwelt kommunizieren. Während Alice recht sorglos mit der neuen Gabe ihrer Tochter umgeht, bemerkt Lina, dass die scheinbar friedlichen Geister immer mehr Besitz von ihrer Schwester zu ergreifen scheinen – und wendet sich hilfesuchend an Pater Hogan (Henry Thomas) …
Meine Meinung
Wenn schon, denn schon: Zur Vorbereitung auf „Ouija: Ursprung des Bösen“ habe ich mir auch noch mal dessen Vorgänger (bzw. eigentlich ja Fortsetzung) „Ouija – Spiel nicht mit dem Teufel“ angeschaut. Und entgegen der allgemeinen Meinung bleibe ich bei dem, was ich bereits 2015 in wenigen Sätzen geschrieben habe: Definitiv alles andere als ein Meisterwerk, aber absolut guckbar. Insofern war ich einem weiteren Ouija-Film gegenüber generell ohnehin nicht abgeneigt. Als dann auch noch die Info kam, dass Mike Flanagan, der mit „Oculus“ und „Still“ zwei extrem stimmige Genrebeiträge abgeliefert hat, die Regie übernehmen würde, stellte sich sogar eine gewisse Vorfreude bei mir ein. Zu recht (so viel sei direkt verraten): „Ouija: Ursprung des Bösen“ legt qualitativ nämlich eine ordentliche Schippe drauf und ist somit nicht nur guckbar, sondern eine echte Empfehlung!
Blasse Charaktere, eine gehetzte Geschichte und der kaum vorhandene Spannungsbogen waren die Hauptkritikpunkte des ersten Ouija-Films. Mike Flanagan hat sich allen drei vorbildlich angenommen und zwar keinen besonders innovativen, aber einen im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten schon beinahe perfekten Gruselfilm der alten Schule abgeliefert. Die sich behutsam entwickelnde Geschichte gibt den Figuren genügend Zeit, während gleichzeitig die Bedrohung von Anfang an spürbar ist und wie ein dunkler Schatten über dem nur scheinbar harmlosen Treiben liegt. Die Spannung wird dabei durch Kleinigkeiten stetig steigert, bis sie sich (im schon beinahe zu actionreichen) Finale entlädt. Ein besonderes Lob gebührt Mike Flanagan außerdem für die gelungene 60er-Jahre-Atmosphäre, die er sogar beim alten Universal-Logo, bei der Titeleinblendung und durch das Einblenden von Filmrollenwechsel-Löchern im Bild berücksichtigt hat. Ich liebe solche Kleinigkeiten!
Von den Hauptdarstellern kann insbesondere die kleine Lulu Wilson punkten. Wenn sie dem Freund ihrer großen Schwester ein ganz bestimmtes Erlebnis detailliert beschreibt und dem Romeo danach grinsend eine gute Nacht wünscht, läuft es einem als Zuschauer eiskalt den Rücken herunter. Sehr gefreut habe ich mich außerdem über den kurzen Gastauftritt von „Still“-Hautdarstellerin Kate Siegel. Und nach dem Abspann gibt es dann sogar noch ein Wiedersehen mit Lin Shaye, welches direkt eine Brücke zum Vorgänger schlägt. Nett!
Mein Fazit
Atmosphärisch mehr als gelungener Gruselfilm mit sympathischen Figuren, der das Rad zwar nicht neu erfindet, dem Vorgänger jedoch in allen Punkten deutlich überlegen ist.
Meine Wertung: 8/10
Ihr möchtet noch andere Meinungen zu „Ouija: Ursprung des Bösen“ lesen? Dann mal los:
Kino7.de
myofb.de
We Want Media
25. Februar 2017 |
 Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, in denen ich (so wie Millionen andere Menschen) nur für Mel Gibson ins Kino gegangen bin. Heute hingegen muss man als Zuschauer froh sein, den Mann überhaupt noch in irgendwelchen Filmen zu sehen. Es ist schade. So verdammt schade. Statt hier nun etwas zur Person Mel Gibson zu schreiben, empfehle ich euch lieber Duoscopes Porträt: Wahn und Wirklichkeit des Mel Gibson – und widme mich stattdessen direkt seinem letzten Film, dem Actiondrama „Blood Father“.
Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, in denen ich (so wie Millionen andere Menschen) nur für Mel Gibson ins Kino gegangen bin. Heute hingegen muss man als Zuschauer froh sein, den Mann überhaupt noch in irgendwelchen Filmen zu sehen. Es ist schade. So verdammt schade. Statt hier nun etwas zur Person Mel Gibson zu schreiben, empfehle ich euch lieber Duoscopes Porträt: Wahn und Wirklichkeit des Mel Gibson – und widme mich stattdessen direkt seinem letzten Film, dem Actiondrama „Blood Father“.
Worum geht’s
Seit Jahren hat John Link (Mel Gibson) nichts mehr von seiner Tochter Lydia (Erin Moriarty) gehört, nun hat er sie plötzlich, mit zittriger Stimme um Geld bittend, am Telefon. Und Lydia zittert zu Recht: Seit sie versehentlich ihren kriminellen Freund Jonah (Diego Luna) erschossen hat, versuchen dessen Männer sie umzubringen. Zum Glück für Lydia hat auch ihr Vater eine kriminelle Vergangenheit und immer noch Kontakte in der Szene. Schon bald findet John heraus, dass hinter der Jagd auf seine Tochter mehr steckt als reine Rache …
Meine Meinung
Als deutscher Zuschauer darf man sich gleich zu Beginn auf eine Überraschung gefasst machen: Mel Gibson wird nicht von seinem Stammsprecher Elmar Wepper synchronisiert, sondern von Martin Umbach. Dieser spricht sonst z.B. Russell Crowe, macht seine Sache aber hervorragend, so dass der stimmliche Wechsel nach ein paar Minuten der Umgewöhnung keine Rolle mehr spielt. Außerdem gibt es in „Blood Father“ noch andere Veränderungen an Mel Gibson, die von der Stimme ablenken. Zum Beispiel der scheinbar unkontrolliert wuchernde Bart. Oder die Muskeln. Meine Fresse, was hat der Mann an Muskelmasse zugelegt. Da fühle ich mich gleich noch spiddeliger als ohnehin schon. Wie dem auch sei, zu der Rolle des mittellosen Ex-Knackis passt Gibsons bulliges, leicht verkommendes Aussehen wie die Faust aufs Auge. Und auch darstellerisch zeigt Gibson einmal mehr, was noch in ihm steckt. Sowohl in den ruhigen Momenten mit seiner Filmtochter als auch in den Actionszenen weiß der inzwischen 61-Jährige nach wie vor zweifellos zu überzeugen.
Letztere hätten dabei ruhig etwas zahlreicher vorkommen dürfen. Dass Regisseur Jean-François Richet packende Actionthriller inszenieren kann, hat er mit dem mehr als nur gelungenen Remake „Das Ende – Assault on Precinct 13“ bewiesen. In „Blood Father“ hingegen hält Richet sich mit der Action (zu) stark zurück und rückt stattdessen das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Tochter in den Vordergrund. Dadurch wird der Film zwar alles andere als langweilig, doch hatte ich des Öfteren das Gefühl, als bekäme ich hier lediglich eine Light-Version dessen zu sehen, was bei der Prämisse möglich gewesen wäre. Zumal das Tempo erst im letzten Drittel ordentlich anzieht und in einem überraschend inkonsequenten konsequenten (ja, dieser scheinbare Widerspruch ist gewollt) Finale mündet.
Wer sich auf einen Film mit leicht angezogener Handbremse einstellt, wird von „Blood Father“ nicht enttäuscht werden. Und als Mel-Gibson-Fan macht man hier sowieso nichts verkehrt, zumal trotz der düsteren Geschichte sogar sein komödiantisches Talent ab und an durchblitzt. Einen Knaller wie „Taken“ aka „96 Hours“ solltet ihr aber nicht erwarten.
Mein Fazit
Nicht überwältigende, aber durchaus gelungene Mischung aus Drama und Actionthriller, der ein wenig mehr Tempo und Action nicht geschadet hätten. Auf jeden Fall lässt sich festhalten: Mel Gibson kann’s noch!
Meine Wertung: 7/10
15. Januar 2017 |
 John Cusack und Samuel L. Jackson in der Verfilmung eines Romans von Stephen King – von welchem Film ist hier die Rede? Nein, nicht von „Zimmer 1408“ (welchen ich persönlich nach wie vor grandios finde), sondern von „Puls“. Dieser sollte ursprünglich von Eli Roth inszeniert werden, später dann als Miniserie erscheinen und erblickt nun doch als Film in Form einer Direct-to-Video-Premiere das Licht der Welt. Und wer nun befürchtet, dieses Hin und Her könnte dem Film geschadet haben, dem entgegne ich entschieden: Stimmt.
John Cusack und Samuel L. Jackson in der Verfilmung eines Romans von Stephen King – von welchem Film ist hier die Rede? Nein, nicht von „Zimmer 1408“ (welchen ich persönlich nach wie vor grandios finde), sondern von „Puls“. Dieser sollte ursprünglich von Eli Roth inszeniert werden, später dann als Miniserie erscheinen und erblickt nun doch als Film in Form einer Direct-to-Video-Premiere das Licht der Welt. Und wer nun befürchtet, dieses Hin und Her könnte dem Film geschadet haben, dem entgegne ich entschieden: Stimmt.
Worum geht’s
Eben noch sucht Comiczeichner Clay (John Cusack) auf dem Flughafen nach einer Möglichkeit sein Smartphone aufzuladen, da ertönt plötzlich ein mysteriöses Signal aus den Handys und verwandelt alle telefonierenden Menschen in reißende Bestien. Nur mit Glück können er und der U-Bahn-Fahrer Tom (Samuel L. Jackson) der tödlichen Situation entkommen und sich in Clays Wohnung in Sicherheit bringen. Während die Welt im Chaos versinkt, machen sich Clay, Tom und Nachbarin Alice (Isabelle Fuhrman) auf die Suche nach Clays Frau Sharon (Clark Sarullo), deren gemeinsamen Sohn Johnny (Ethan Andrew Casto) und einem sicheren Zufluchtsort …
Meine Meinung
Kennt ihr das? Ihr schaut einen Film und denkt „Mensch, diese Situation hätte packend sein können, wenn …“ oder „Okay, das sollte jetzt vermutlich spannend sein, aber …“? So ging es mir bei „Puls“. Und das praktisch ununterbrochen.
Zugegeben, das erste Auftreten des Signals ist durchaus gelungen. Nicht nur, dass das Geräusch selbst wirklich unangenehm ist, auch das darauf folgende Chaos wurde rasant inszeniert und macht Lust auf mehr. Doch leider baut der Film unmittelbar nach dem flotten Einstieg auch direkt wieder ab. Und das deutlich.
So laufen nicht nur die späteren Angriffe der Zombies so genannten Phoner überraschungsarm und wenig kreativ ab, auch die gesamte Geschichte entwickelt sich zwischenzeitlich in verschiedene Richtungen, bis man als Zuschauer nicht mehr weiß, was das Ganze denn nun eigentlich zu bedeuten hat und wohin die ganze Chose schlussendlich führen soll. Phoner, die telepathisch miteinander verbunden sind. Ein Antagonist, der Clays Comicfigur ähnelt. Gemeinsame Alpträume. Vieles wird angedeutet, doch nichts wird zu einem befriedigenden Ende gebracht. Es wirkt fast so, als wäre der Topf voller guter Ideen gewesen, dann aber schlicht die Zeit ausgegangen, um diese auch alle komplett umzusetzen. Was mich zu der Vermutung hinreißen lässt, dass eine Miniserie vielleicht doch die bessere Variante gewesen wäre.
Leider bleiben auch die Charaktere erschreckend flach und unausgearbeitet. Dass in einem Endzeitszenario wie diesem früher oder später auch unter den Sympathieträgern schwere Entscheidungen zu treffen und Opfer zu beklagen sind, ist keine große Überraschung. Doch werden diese Situationen in „Puls“ so oberflächlich und nach Vorschrift abgearbeitet, dass jegliches Mitgefühl für die Figuren im Keim erstickt wird. Passend dazu spielen sowohl John Cusack als auch Samuel L. Jackson so emotionslos, als würden sie stur auf Autopilot laufen. Lediglich Isabelle Fuhrman, die mich bereits in dem spannenden Thriller „Orphan – Das Waisenkind“ zu beeindrucken wusste, schafft es, ihrer Figur zumindest ansatzweise so was wie Charakter zu verleihen.
Hmm, das liest sich jetzt alles ziemlich katastrophal, doch ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht. So sind ein John Cusack oder ein Samuel L. Jackson auf Autopilot immer noch besser als die typischen Darsteller in billig heruntergekurbelten C-Horrorfilmen (kurz zuvor habe ich „Wrong Turn 6: Last Resort“ gesehen, spreche also aus Erfahrung). Und auch wenn die Geschichte unausgegoren wirkt, so gibt es doch immerhin Stellen, die durchaus Potenzial erkennen lassen. Kurz: Für einen regnerischen Nachmittag vor dem Fernseher reicht’s allemal – mehr als einen anspruchslosen Zeitvertreib für zwischendurch solltet ihr aber nicht erwarten.
Mein Fazit
Gute, aber leider auch gelangweilt wirkende Darsteller in einem Film voller verschenkter Möglichkeiten. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Aber auch deutlich weniger, wie ein Blick auf andere Stephen-King-Verfilmungen beweist.
Meine Wertung: 5/10
28. Dezember 2016 |
 Zwei Jahre lang hat Will (Logan Marshall-Green) nichts von seiner Ex-Frau gehört, nun erhalten er und seine neue Lebensgefährtin Kira (Emayatzy Corinealdi) eine Einladung zu einer Dinnerparty. Gemeinsam mit all ihren wichtigsten Freunden möchten Eden (Tammy Blanchard) und ihr neuer Mann David (Michiel Huisman) einen schönen Abend verbringen. Während die offensichtlich zutiefst glücklichen Eden und David teuren Wein servieren und von ihrer Zeit in Mexiko schwärmen, entwickelt Will ob des doch sehr eigenwilligen Verhaltens zunehmend Zweifel an den Absichten der Gastgeber. Doch sind es wirklich Eden und David, die sich merkwürdig benehmen? Oder ist Wills immer paranoider wirkendes Verhalten nur das Ergebnis des von ihm nicht verarbeiteten Unfalltods des gemeinsamen Sohnes?
Zwei Jahre lang hat Will (Logan Marshall-Green) nichts von seiner Ex-Frau gehört, nun erhalten er und seine neue Lebensgefährtin Kira (Emayatzy Corinealdi) eine Einladung zu einer Dinnerparty. Gemeinsam mit all ihren wichtigsten Freunden möchten Eden (Tammy Blanchard) und ihr neuer Mann David (Michiel Huisman) einen schönen Abend verbringen. Während die offensichtlich zutiefst glücklichen Eden und David teuren Wein servieren und von ihrer Zeit in Mexiko schwärmen, entwickelt Will ob des doch sehr eigenwilligen Verhaltens zunehmend Zweifel an den Absichten der Gastgeber. Doch sind es wirklich Eden und David, die sich merkwürdig benehmen? Oder ist Wills immer paranoider wirkendes Verhalten nur das Ergebnis des von ihm nicht verarbeiteten Unfalltods des gemeinsamen Sohnes?
Hui, was für ein toller Film! Dass „The Invitation“ ein kleiner Geheimtipp sein soll, hatte ich ja schon öfter gelesen – aber dass er mir so gut gefallen würde, das habe ich dann doch nicht erwartet. Dabei passiert in dieser kleinen Thrillerperle eine lange Zeit augenscheinlich nur wenig. Menschen bzw. Freunde sitzen an einem Tisch und unterhalten sich. Das war’s. Doch in jedem dieser scheinbar banalen Gespräche, in jedem freundlichen Lächeln, in jeder noch so kleinen Geste steckt etwas Unheilvolles, das mich von Anfang an packte. Viele Kleinigkeiten, die einzeln betrachtet unbedeutend erscheinen, wirken in ihrer Gesamtheit plötzlich bedrohlich. Wieso sind die Fenster vergittert? Wieso schließt David die Haustür ab und steckt den Schlüssel ein? Und wo bleibt eigentlich der letzte Gast? Dass Will die Party mit Skepsis beobachtet, kann man als Zuschauer nur allzu gut nachvollziehen. Ob diese Skepsis gerechtfertigt ist, lässt der Film lange Zeit offen – und soll an dieser Stelle auch nicht verraten werden.
Fast noch spannender als die Auflösung ist die Frage, wie wir selbst in solch einer Situation handeln würden. Würden wir nett lächelnd über das merkwürdige Verhalten gewisser Personen hinwegsehen? Würden wir unsere Freunde offen darauf ansprechen? Oder würden wir einfach gehen? Wo würden wir, bei aller Toleranz, die Grenze ziehen? Alleine für diese Fragen lohnt es sich, den Film ein zweites Mal zu schauen – und dabei ruhig auch mal unsere Gesellschaft und insbesondere sich selbst zu hinterfragen.
Dass „The Invitation“ so gut funktioniert, verdankt der Film nicht nur dem so langsamen wie effektiven Spannungsaufbau, sondern auch der tollen Kameraarbeit, dem bedrohlichen Score und insbesondere Hauptdarsteller Logan Marshall-Green („Devil“, „Prometheus“). Dieser ist mit Vollbart und Zottelmähne zwar fast nicht wiederzuerkennen, zeigt unter all den Haaren aber ein enormes Spektrum an menschlichen Gefühlen. Toll!
Falls ihr es noch nicht bemerkt habt: Ich bin wirklich begeistert von diesem Film! Alleine dafür hat sich das Netflix-Abo diesen Monat schon wieder gelohnt. Die Blu-ray habe ich für meine Sammlung trotzdem zusätzlich bestellt. Einen Platz in meinem Filmregal hat sich „The Invitation“ definitiv verdient!
Meine Wertung: 9/10
17. November 2016 |
 An dieser Stelle sollte eigentlich eine raffiniert formulierte Einleitung stehen, die meine Vergangenheit als Kampfsportler (man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich war tatsächlich jahrelang aktiver Karateka), mein Alter (den 89er „Kickboxer“ habe ich damals sogar im Kino gesehen) und das ab morgen erhältliche Remake „Kickboxer: Die Vergeltung“ miteinander in Verbindung bringt. Sollte. Doch nach 3 1/2 Tagen Betreuung eines Messestandes bin ich zu der hierfür notwendigen verbalen Genialität einfach nicht mehr in der Lage. Also müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was ihr eben gelesen habt. Tut mir leid …
An dieser Stelle sollte eigentlich eine raffiniert formulierte Einleitung stehen, die meine Vergangenheit als Kampfsportler (man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich war tatsächlich jahrelang aktiver Karateka), mein Alter (den 89er „Kickboxer“ habe ich damals sogar im Kino gesehen) und das ab morgen erhältliche Remake „Kickboxer: Die Vergeltung“ miteinander in Verbindung bringt. Sollte. Doch nach 3 1/2 Tagen Betreuung eines Messestandes bin ich zu der hierfür notwendigen verbalen Genialität einfach nicht mehr in der Lage. Also müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was ihr eben gelesen habt. Tut mir leid …
Worum geht’s
Von der Promoterin Marcia (Gina Carano) wird Karate-Weltmeister Eric Sloane (Darren Shahlavi) nach Thailand gelockt, um dort gegen den ungeschlagenen Champion Tong Po (Dave Bautista) anzutreten. Erics jüngerer Bruder Kurt (Alain Moussi) ist zwar gegen diesen Kampf, reist Eric aber hinterher, um ihm am Ring beizustehen. Dort kann Kurt jedoch nur hilflos mitansehen, wie Tong Po seinen Bruder brutal tötet. Vom Gedanken an Rache getrieben, versucht Kurt Tong Po zu erschießen, scheitert jedoch und muss bei dem zurückgezogen lebenden Meister Durand (Jean-Claude Van Damme) untertauchen. Nach anfänglichem Zögern erklärt Durand sich bereit, Kurt zu trainieren und auf den alles entscheidenden Kampf gegen Tong Po vorzubereiten …
Meine Meinung
Ja, sie sind irgendwie dämlich. Und ja, sie sind definitiv nicht mehr zeitgemäß. Aber das ist mir egal. Ich vermisse einfach diese sinnlosen Martial-Arts-Filme, in denen der hoffnungslos unterlegene Held erst ordentlich auf die Omme bekommt, dann ein paar Wochen trainiert, erneut auf seinen Erzfeind trifft, auch dieses Mal zu verlieren droht, den Kampf dann aber zu heroischer Musik dreht und als Sieger den Ring verlässt. „Karate Kid“, „Karate Tiger“, „Kickboxer“ – diese Filme haben meine Jugend geprägt. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass solche Filme heute so gut wie nicht mehr gedreht werden.
Umso euphorischer war ich, als ich erstmalig las, dass es ein Remake von „Kickboxer“ geben würde – und das sogar mit Jean-Claude Van Damme in einer (größeren) Nebenrolle. Nachdem ich den Film nun gesehen habe, stellt sich jedoch eine gewisse Ernüchterung ein. Versteht mich dabei bitte nicht falsch: „Kickboxer: Die Vergeltung“ ist kein schlechter Film. Sofern ihr, wie ich, ein Fan anspruchsloser Martial-Arts-Filme seid.
Die Handlung *räusper* wird flott erzählt und die überraschend zahlreichen Kämpfe sind abwechslungsreich, auf eine positive Art und Weise altmodisch und dabei erfreulich übersichtlich choreografiert. Außerdem … nein, das war’s eigentlich auch schon. Mehr zeichnet Filme wie diesen ohnehin nicht aus, also verzichte ich auch darauf, diesen Text künstlich aufzublähen.
Was dem Film leider fehlt, ist der naive Charme des Originals. Die heroische Musik im finalen Kampf (das kann doch so schwer nicht sein). Und, jetzt bitte nicht lachen, ein Hauptdarsteller wie Jean-Claude Van Damme. Denn auch wenn Alain Moussi ein begnadeter Kämpfer und absolut nicht unsympathisch ist, so fehlt ihm dann doch das Charisma des berühmten Belgiers. Dieser darf übrigens gleich mehrere Kämpfe bestreiten und beweisen, wie fit er mit Mitte 50 noch immer ist. Ich bin ehrlich beeindruckt.
Mein Fazit
Solider Martial-Arts-Streifen mit schick gefilmten Kämpfen, aber einem viel zu blassen Hauptdarsteller. Jean-Claude Van Damme reißt’s aber definitiv raus!
Meine Wertung: 6/10
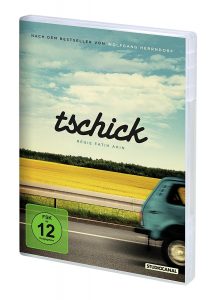 Ich geb’s zu: Der deutsche Film und ich, wir sind nicht so richtig kompatibel. Dementsprechend gibt es nur wenige deutsche Filme, die mir wirklich gut gefallen. Aaaaber, es gibt sie. „Das Experiment“, „Die Welle“, „Wir sind die Nacht“ oder auch „Die Nacht der lebenden Loser“ und „Fack ju Göhte“, um mal zwei weit weniger düstere Beispiele zu nennen. Nichtsdestoweniger langweilen mich die meisten deutschen Filme einfach nur. Ob dies nun daran liegt, dass die meisten Filme tatsächlich langweilig sind, oder meine Sehgewohnheiten schlicht zu sehr von amerikanischen Produktionen geprägt wurden, lasse ich mal dahingestellt. Viel wichtiger ist an dieser Stelle doch: Wo reiht sich Fatih Akins „Tschick“ ein?
Ich geb’s zu: Der deutsche Film und ich, wir sind nicht so richtig kompatibel. Dementsprechend gibt es nur wenige deutsche Filme, die mir wirklich gut gefallen. Aaaaber, es gibt sie. „Das Experiment“, „Die Welle“, „Wir sind die Nacht“ oder auch „Die Nacht der lebenden Loser“ und „Fack ju Göhte“, um mal zwei weit weniger düstere Beispiele zu nennen. Nichtsdestoweniger langweilen mich die meisten deutschen Filme einfach nur. Ob dies nun daran liegt, dass die meisten Filme tatsächlich langweilig sind, oder meine Sehgewohnheiten schlicht zu sehr von amerikanischen Produktionen geprägt wurden, lasse ich mal dahingestellt. Viel wichtiger ist an dieser Stelle doch: Wo reiht sich Fatih Akins „Tschick“ ein?
 Immer öfter höre oder lese ich, dass Horrorfilme heutzutage gar nicht mehr richtig gruselig wären. Gleichzeitig erlebe ich, dass besagte Horrorfilme bei Tageslicht auf einem kleinen Notebook-Bildschirm geschaut werden, während sich nebenbei unterhalten oder mit dem Smartphone gespielt wird (ja, das ist ein Extrembeispiel). Mal ehrlich, Leute: So kann ja auch keine unheimliche Atmosphäre aufkommen!
Immer öfter höre oder lese ich, dass Horrorfilme heutzutage gar nicht mehr richtig gruselig wären. Gleichzeitig erlebe ich, dass besagte Horrorfilme bei Tageslicht auf einem kleinen Notebook-Bildschirm geschaut werden, während sich nebenbei unterhalten oder mit dem Smartphone gespielt wird (ja, das ist ein Extrembeispiel). Mal ehrlich, Leute: So kann ja auch keine unheimliche Atmosphäre aufkommen! Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, in denen ich (so wie Millionen andere Menschen) nur für Mel Gibson ins Kino gegangen bin. Heute hingegen muss man als Zuschauer froh sein, den Mann überhaupt noch in irgendwelchen Filmen zu sehen. Es ist schade. So verdammt schade. Statt hier nun etwas zur Person Mel Gibson zu schreiben, empfehle ich euch lieber Duoscopes
Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, in denen ich (so wie Millionen andere Menschen) nur für Mel Gibson ins Kino gegangen bin. Heute hingegen muss man als Zuschauer froh sein, den Mann überhaupt noch in irgendwelchen Filmen zu sehen. Es ist schade. So verdammt schade. Statt hier nun etwas zur Person Mel Gibson zu schreiben, empfehle ich euch lieber Duoscopes  John Cusack und Samuel L. Jackson in der Verfilmung eines Romans von Stephen King – von welchem Film ist hier die Rede? Nein, nicht von „
John Cusack und Samuel L. Jackson in der Verfilmung eines Romans von Stephen King – von welchem Film ist hier die Rede? Nein, nicht von „ Zwei Jahre lang hat Will (Logan Marshall-Green) nichts von seiner Ex-Frau gehört, nun erhalten er und seine neue Lebensgefährtin Kira (Emayatzy Corinealdi) eine Einladung zu einer Dinnerparty. Gemeinsam mit all ihren wichtigsten Freunden möchten Eden (Tammy Blanchard) und ihr neuer Mann David (Michiel Huisman) einen schönen Abend verbringen. Während die offensichtlich zutiefst glücklichen Eden und David teuren Wein servieren und von ihrer Zeit in Mexiko schwärmen, entwickelt Will ob des doch sehr eigenwilligen Verhaltens zunehmend Zweifel an den Absichten der Gastgeber. Doch sind es wirklich Eden und David, die sich merkwürdig benehmen? Oder ist Wills immer paranoider wirkendes Verhalten nur das Ergebnis des von ihm nicht verarbeiteten Unfalltods des gemeinsamen Sohnes?
Zwei Jahre lang hat Will (Logan Marshall-Green) nichts von seiner Ex-Frau gehört, nun erhalten er und seine neue Lebensgefährtin Kira (Emayatzy Corinealdi) eine Einladung zu einer Dinnerparty. Gemeinsam mit all ihren wichtigsten Freunden möchten Eden (Tammy Blanchard) und ihr neuer Mann David (Michiel Huisman) einen schönen Abend verbringen. Während die offensichtlich zutiefst glücklichen Eden und David teuren Wein servieren und von ihrer Zeit in Mexiko schwärmen, entwickelt Will ob des doch sehr eigenwilligen Verhaltens zunehmend Zweifel an den Absichten der Gastgeber. Doch sind es wirklich Eden und David, die sich merkwürdig benehmen? Oder ist Wills immer paranoider wirkendes Verhalten nur das Ergebnis des von ihm nicht verarbeiteten Unfalltods des gemeinsamen Sohnes? An dieser Stelle sollte eigentlich eine raffiniert formulierte Einleitung stehen, die meine Vergangenheit als Kampfsportler (man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich war tatsächlich jahrelang aktiver Karateka), mein Alter (den 89er „Kickboxer“ habe ich damals sogar im Kino gesehen) und das ab morgen erhältliche Remake „Kickboxer: Die Vergeltung“ miteinander in Verbindung bringt. Sollte. Doch nach 3 1/2 Tagen Betreuung eines Messestandes bin ich zu der hierfür notwendigen verbalen Genialität einfach nicht mehr in der Lage. Also müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was ihr eben gelesen habt. Tut mir leid …
An dieser Stelle sollte eigentlich eine raffiniert formulierte Einleitung stehen, die meine Vergangenheit als Kampfsportler (man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich war tatsächlich jahrelang aktiver Karateka), mein Alter (den 89er „Kickboxer“ habe ich damals sogar im Kino gesehen) und das ab morgen erhältliche Remake „Kickboxer: Die Vergeltung“ miteinander in Verbindung bringt. Sollte. Doch nach 3 1/2 Tagen Betreuung eines Messestandes bin ich zu der hierfür notwendigen verbalen Genialität einfach nicht mehr in der Lage. Also müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was ihr eben gelesen habt. Tut mir leid …